
LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung: Lokales Engagement wird gefördert, doch Zusatznutzen ist noch immer nicht ausreichend nachgewiesen
Über den Bericht:LEADER ist der partizipatorische Bottom-up-Ansatz der EU zur Einbindung der örtlichen Bevölkerung in Projektenwicklungs- und Entscheidungsprozesse. Im Vergleich zu herkömmlichen (Top-down-)Ausgabenprogrammen der EU bringt er zusätzliche Kosten und Risiken mit sich. Der Hof untersuchte, ob der LEADER-Ansatz einen Nutzen brachte, der die mit ihm verbundenen zusätzlichen Kosten und Risiken rechtfertigte, und knüpfte damit an seinen Sonderbericht zu dem Thema aus dem Jahr 2010 an. Er stellte fest, dass mehr als zehn Jahre später in einigen Bereichen Verbesserungen zu verzeichnen sind und der LEADER-Ansatz das Engagement der lokalen Bevölkerung fördert. Nichtsdestoweniger gibt es nach wie vor wenige Belege dafür, dass der Nutzen gegenüber dessen Kosten und Risiken überwiegt. Der Hof empfiehlt der Kommission, die Kosten und den Nutzen von LEADER sowie den Ansatz der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung umfassend zu bewerten.
Sonderbericht des Hofes gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV.
Zusammenfassung
I Die EU hat das LEADER-Programm 1991 als Bottom-up-Initiative eingeführt, um die Entwicklung benachteiligter ländlicher Regionen durch Projekte zu fördern, mit denen auf lokale Bedürfnisse reagiert wird. Seit 2014 nutzt die EU den LEADER-Ansatz (bekannt als von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung) im Rahmen mehrerer EU-Finanzierungsquellen für ländliche, städtische und Küstengebiete.
II Das Hauptmerkmal des LEADER-Ansatzes ist, dass partizipatorische und Bottom-up-Methoden verwendet werden, um die örtliche Bevölkerung in die Projektenwicklungs- und Entscheidungsprozesse einzubinden. Lokale Aktionsgruppen, bestehend aus Partnern aus dem öffentlichen und dem privaten Sektor und der Zivilgesellschaft, steuern die Aktivitäten. Im Zeitraum 2014–2020 plante die EU, Finanzmittel in Höhe von 9,2 Milliarden Euro für LEADER und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung bereitzustellen.
III Im Vergleich zu herkömmlichen (Top-down-)Ausgabenprogrammen der EU bringt der LEADER-Ansatz zusätzliche Kosten und Risiken mit sich. Zusätzliche Kosten ergeben sich aus der Einrichtung und Aufrechterhaltung der Verwaltungsstrukturen lokaler Aktionsgruppen. Weitere Risiken entstehen durch die langen Verfahren, zusätzliche administrative Auflagen für Projektträger und potenzielle Interessenkonflikte.
IV Manche dieser zusätzlichen Kosten und Risiken sind gerechtfertigt, wenn lokale Aktionsgruppen einen Zusatznutzen im Vergleich zu herkömmlichen (Top-down-)Ausgabenprogrammen der EU erbringen. Laut den Leitlinien der Kommission soll sich dieser Nutzen in einem verbesserten Sozialkapital, einer verbesserten lokalen Governance und besseren Projektergebnissen niederschlagen.
V Die Prüfung des Hofes bezieht sich auf den EU-Förderzeitraum 2014–2020. Der Hof untersuchte, ob der LEADER-Ansatz insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen (Top-down-)Ausgabenprogrammen der EU einen Nutzen erbrachte, der die mit ihm verbundenen zusätzlichen Kosten und Risiken rechtfertigt. Um dies zu bewerten, untersuchte der Hof, ob durch diesen Ansatz das lokale Engagement gefördert wurde und zu Projekten mit nachweisbarem Nutzen im Sinne einer verbesserten lokalen Governance, eines verbesserten Sozialkapitals und besserer Ergebnisse führte. Der Hof untersuchte außerdem, ob sich die Einführung des neuen Multifonds-Ansatzes in einer besseren Koordinierung der Unterstützung für die lokale Entwicklung niederschlug.
VI Im Rahmen dieser Prüfung wurde auch untersucht, ob die im Sonderbericht des Hofes aus dem Jahr 2010 zum LEADER-Programm ermittelten Schwachstellen von der Kommission angegangen wurden. Der Hof beabsichtigt, der Kommission mit diesem Bericht Erkenntnisse sowie zeitnahe Empfehlungen für die laufende Bewertung des LEADER-Ansatzes an die Hand zu geben.
VII Mehr als ein Jahrzehnt nach dem LEADER-Sonderbericht aus dem Jahr 2010 zeigt die Prüfung des Hofes, dass es in einigen Bereichen zu Verbesserungen gekommen ist und durch den LEADER-Ansatz das lokale Engagement gefördert wird. Es gibt jedoch nur wenige Belege dafür, dass der Nutzen des LEADER-Ansatzes gegenüber den mit ihm verbundenen Kosten und Risiken überwiegt.
VIII Während die meisten Mitgliedstaaten geeignete Verfahren für die Auswahl und Genehmigung lokaler Aktionsgruppen anwendeten, legten einige bei der Auswahl lokaler Entwicklungsstrategien weniger anspruchsvolle Qualitätsstandards an. Der Hof stellte fest, dass ein Mitgliedstaat im Rahmen seines Auswahlverfahrens gar keine Qualitätskriterien anwendete. Das Verfahren zur Projektbeantragung und ‑genehmigung (bestehend aus bis zu acht Schritten) war kompliziert und brachte für Projektträger im Vergleich zu herkömmlichen Ausgabenprogrammen zusätzliche administrative Auflagen mit sich. Die mit der Projektauswahl befassten Stellen wurden nicht mehr von Behörden dominiert (wie der Hof 2010 festgestellt hatte), sie waren jedoch oftmals nicht repräsentativ für die örtliche Bevölkerung oder es gab kein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen.
IX Der Hof stellte fest, dass von den lokalen Aktionsgruppen Projekte ausgewählt wurden, die mit den in ihren lokalen Entwicklungsstrategien festgelegten allgemeinen Zielen übereinstimmten. Einige Mitgliedstaaten und lokale Aktionsgruppen verwendeten LEADER dazu, gesetzliche Aufgaben von nationalen, regionalen oder Gemeindebehörden oder sonstige Aktivitäten zu finanzieren, für die auf EU- oder nationaler Ebene andere spezifische Förderprogramme existierten.
X Während zwei der sechs Empfehlungen des Hofes aus dem Jahr 2010 umgesetzt wurden, stellte der Hof fest, dass der Begleitungs- und Bewertungsrahmen der Kommission noch immer keine Belege für den Zusatznutzen des LEADER-Ansatzes liefert. In seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2018 zu den Vorschlägen der Kommission für die neue Gemeinsame Agrarpolitik betonte der Hof, dass die Kommission bei der Überarbeitung bestehender Rechtsvorschriften den Grundsatz der vorherigen Evaluierung beachten sollte. Die Kommission bewertet derzeit den Nutzen von LEADER.
XI Angesichts der zusätzlichen Kosten und Risiken im Vergleich zu anderen Fördermodellen und des nach wie vor nicht nachweisbaren Nutzens empfiehlt der Hof der Kommission, Kosten und Nutzen von LEADER und der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung zu bewerten.
Einleitung
Die Entwicklung des LEADER-Ansatzes
01 Der 1991 eingeführte LEADER-Ansatz stellt die partizipatorische Bottom-up-Methode der EU für die Entwicklung des ländlichen Raums dar, die später auf städtische und Küstengebiete ausgeweitet wurde. Im Zentrum stehen lokale Aktionsgruppen (LAG) und lokale Fischereiaktionsgruppen (FLAG), die sich aus Mitgliedern aus dem privaten und öffentlichen Sektor im ländlichen Raum und in Küstengebieten zusammensetzen. Lokale Aktionsgruppen motivieren die Bevölkerung, sich an der Gestaltung einer lokalen Entwicklungsstrategie zu beteiligen, und sind für die Initiierung und Finanzierung von Projekten entsprechend dem lokalen Bedarf verantwortlich.
02 Dem LEADER-Konzept liegt die Erwartung zugrunde, dass im Vergleich zur Umsetzung nach der herkömmlichen Top-down-Verwaltung von EU-Fonds ein Mehrwert erzielt wird. Der LEADER-Ansatz stützt sich laut einem "Fact Sheet" der Kommission aus dem Jahr 2006 auf sieben zentrale Merkmale. LEADER beruht auf der Vorstellung, dass Einheimische am besten wissen, wie sich die Entwicklung in ihrem Gebiet vorantreiben lässt ("Bottom-up-Ansatz"). Letzteres wird als kleine zusammengehörige Region (10 000–150 000 Einwohner) mit einer lokalen Identität definiert ("gebietsbezogener Ansatz"). In diesem Gebiet versammeln sich lokale Akteure in einer lokalen Aktionsgruppe ("lokale Partnerschaft"), die eine Verbindung zwischen den lokalen Akteuren herstellt ("Vernetzung"). Darüber hinaus beteiligen sich lokale Aktionsgruppen in verschiedenen Regionen oder Mitgliedstaaten an gemeinsamen Projekten, um an gemeinsamen Lösungen für ähnliche lokale Herausforderungen zu arbeiten ("Kooperation"). Durch Bottom-up-Ansätze und den Austausch zwischen verschiedenen lokalen Sektoren ("integrierte und multisektorale Strategie") soll lokales Potenzial mobilisiert werden. Lokale Gruppen sollten am besten in der Lage sein, integrierte lokale Lösungen für lokale Probleme zu finden, können schneller reagieren und neue Lösungsansätze für die lokale Entwicklung aufzeigen ("Innovationsförderung"). Durch die Einbindung in die lokale Entscheidungsfindung sollen Mitwirkungsbereitschaft und verstärktes Engagement erzeugt werden, was zu einer besseren, nachhaltigeren lokalen Entwicklung des ländlichen Raums führen kann.1
03 Wie der Hof in seinem Bericht2 aus dem Jahr 2010 feststellte, sollen mit dem LEADER-Ansatz durch Entwicklung und Umsetzung von Strategien sowie Ressourcenzuweisung auf lokaler Ebene das Engagement und die Einflussnahme der örtlichen Bevölkerung gefördert werden. Dadurch sollen das Wissen und die Erfahrung der örtlichen Bevölkerung im Hinblick auf die Ermittlung ihres Entwicklungsbedarfs genutzt werden.
04 Die Übertragung dieser Aufgaben an lokale Aktionsgruppen bringt zusätzliche Kosten und Risiken mit sich. Zusatzkosten werden etwa durch die Ausgaben der lokalen Aktionsgruppen für die Ausarbeitung und Ausführung ihrer lokalen Entwicklungsstrategien und zur Unterstützung der Begünstigten bei der Projektentwicklung verursacht. Zu diesen Kosten gehören auch die Ausgaben von Mitgliedstaaten für die Genehmigung lokaler Aktionsgruppen (z. B. für das Engagieren von Beratern zur Unterstützung des Genehmigungsverfahrens).
05 Die LEADER-Förderung für Verwaltungs- und Betriebskosten von lokalen Aktionsgruppen ist auf 25 % der gesamten öffentlichen Fördermittel (EU-Finanzmittel plus nationale, regionale und lokale öffentliche Mittel) begrenzt. Die Erleichterung der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie und die Unterstützung potenzieller Begünstigter bei der Projektentwicklung sind in diesen Kosten enthalten.
06 Zusätzliche Risiken entstehen durch lange Verfahren, zusätzliche Auflagen für Projektträger und potenzielle Interessenkonflikte. Weitere Risiken ergeben sich durch Entscheidungsgremien, die für die örtliche Bevölkerung nicht repräsentativ sind oder kein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen aufweisen3.
07 Die Entscheidungsfindung auf lokaler Ebene birgt das Potenzial eines zusätzlichen Nutzens. Im Leitfaden der Kommission zur Bewertung des LEADER-Ansatzes4 wird angeführt, dass sich dieser Nutzen folgendermaßen niederschlägt:
- verbessertes Sozialkapital,
- verbesserte lokale Governance,
- bessere Projektergebnisse.
08 Das Programm zieht seine Daseinsberechtigung daher nicht aus wirtschaftlichen Kriterien wie Marktversagen oder relativer Deprivation. Tatsächlich kann es derzeit in allen ländlichen Gebieten – auch in solchen, deren Wirtschaftsleistung deutlich über dem EU-Durchschnitt liegt – angewendet werden. In einer kürzlich von der Kommission durchgeführten Studie wurde festgestellt, dass semiurbane ländliche Gebiete stärker von der wirtschaftlichen und demografischen Entwicklung der letzten Zeit profitierten als Randgebiete5.
09 Im Zeitraum 2014–2020 war LEADER ein verpflichtender Teil aller Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums. Ab diesem Zeitpunkt mussten die Mitgliedstaaten mit Ausnahme Kroatiens gemäß den EU-Rechtsvorschriften mindestens 5 % ihrer Fördermittel für den ländlichen Raum für LEADER ausgeben. Der Mindestbeitrag Kroatiens im Programmplanungszeitraum 2014–2020 betrug die Hälfte des Prozentsatzes der anderen Mitgliedstaaten, also 2,5 %. Laut den von der Kommission bereitgestellten Daten belaufen sich die für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 geplanten EU-Mittel für LEADER auf 7 Milliarden Euro (rund 7 % der gesamten Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raums). Die Gesamtzahl der LEADER-Projekte (für den Zeitraum 2014–2020) belief sich Ende 2020 auf 143 487. Die Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden auf 2021 und 2022 verlängert.
10 Im Rahmen der EU-Fischereipolitik kommt der LEADER-Ansatz seit 2007 zur Anwendung, und im Zeitraum 2014–2020 wurde die von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokale Entwicklung (Community-Led Local Development, CLLD) eingeführt. Im Rahmen dieses aktualisierten Konzepts wird der LEADER-Ansatz bei allen europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) mit Ausnahme des Kohäsionsfonds angewendet6. Die Weiterentwicklung des LEADER-Ansatzes führte, wie in Abbildung 1 dargestellt, zu einem erheblichen Anstieg der finanziellen Unterstützung und der Zahl der lokalen Aktionsgruppen, insbesondere zu Beginn des Programmplanungszeitraums 2007–2013.
11 Im Zeitraum 2014–2020 plante die EU, Fördermittel in Höhe von 9,2 Milliarden Euro für LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung bereitzustellen (siehe Tabelle 1). Es wurde davon ausgegangen, dass sich die gesamte öffentliche Förderung (einschließlich nationaler Förderung) auf 12,5 Milliarden Euro belaufen würde. Der Großteil davon (76 % des geplanten Betrags und 84 % des bis 2020 bereits geltend gemachten Betrags) bezog sich auf die Entwicklung des ländlichen Raums.
Tabelle 1 – EU-Beitrag nach Finanzierungsquelle (in Millionen Euro, 2014–2020)
| EU-Fonds | Geplant | Finanzmittel für genehmigte Projekte* | Ausgezahlt |
|---|---|---|---|
| Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums | 7 010 | Daten nicht verfügbar** | 3 026 |
| Europäischer Meeres- und Fischereifonds | 548 | 362 | 178 |
| Europäischer Fonds für regionale Entwicklung | 1 095 | 848 | 349 |
| Europäischer Sozialfonds | 530 | 278 | 82 |
| Insgesamt | 9 183 | 3 635 |
* Die Finanzmittel für das genehmigte Projekt entsprechen dem Betrag der EU-Finanzmittel, den die Mitgliedstaaten in ihren Entscheidungen über die Genehmigung von Projekten für Projekte reserviert (gebunden) haben.
** Der Gesamtbetrag der Mittelbindungen (ELER und nationale öffentliche Mittel) beläuft sich auf 7 439 Millionen Euro, eine Aufschlüsselung ist jedoch nicht verfügbar.
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission.
Abbildung 1 – Zunahme der Förderung für LEADER (Anzahl der lokalen Aktionsgruppen und geplante EU-Förderung)

Hinweis: 1991–2006: Unterstützung der Entwicklung des ländlichen Raums (EAGFL und ELER); 2007–2013: ELER und EFF; 2014–2020: ELER, EMFF, EFRE und ESF. * Einschließlich FLAG.
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission.
12 Die nationalen und (je nach politischer Struktur) regionalen Behörden der Mitgliedstaaten erstellten Programmplanungsdokumente wie Partnerschaftsvereinbarungen, operationelle Programme und Programme zur Entwicklung des ländlichen Raums. In diesen Dokumenten waren die nationalen und regionalen Förderprioritäten festgelegt. Die Kommission prüfte und genehmigte diese Dokumente. Die Gesamtverantwortung für die Ausgaben liegt nach wie vor bei der Kommission, die Mitgliedstaaten haben jedoch die lokalen Aktionsgruppen und ihre lokalen Entwicklungsstrategien genehmigt, die Projekt- und Zahlungsanträge bearbeitet und die Ergebnisse überwacht und bewertet. Abbildung 2 sind die wichtigsten Zuständigkeiten der im Rahmen des LEADER-Ansatzes tätigen Akteure zu entnehmen.
Abbildung 2 – Die wichtigsten Zuständigkeiten der im Rahmen des LEADER-Ansatzes zuständigen Akteure

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Dokumenten der Kommission.
13 Für den Zeitraum 2014–2020 hat die Kommission die folgenden Indikatoren7 und Ziele8 zur Begleitung des LEADER-Programms festgelegt:
- Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstrategien gelten (Ziel: 53,5 %),
- Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen profitiert (Ziel: 16,4 %),
- in unterstützten LEADER-Projekten geschaffene Arbeitsplätze (Ziel: 44 109 Arbeitsplätze).
In Anhang I sind die spezifischen Indikatoren und Ziele in Bezug auf LEADER und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung, wie sie in den Verordnungen zu den verschiedenen EU-Fonds festgelegt sind, angeführt.
14 Die Mitgliedstaaten konnten sich entscheiden, ob sie lokale Aktionsgruppen aus einem einzigen EU-Fonds ("Monofonds-Ansatz") oder mehreren Fonds ("Multifonds-Ansatz") unterstützen. Sie konnten auch einen Fonds als "federführenden Fonds" festlegen, der alle Verwaltungskosten der lokalen Aktionsgruppen abdeckt. Im Zeitraum 2014–2020 nutzten 17 der 28 Mitgliedstaaten den Multifonds-Ansatz mit unterschiedlichen Fondskombinationen, um die Unterstützung für die lokale Entwicklung besser zu koordinieren und die Verbindungen zwischen ländlichen, städtischen und Fischereiwirtschaftsgebieten zu stärken (siehe Abbildung 3).
Abbildung 3 – Von den Mitgliedstaaten genutzte Förderansätze

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Angaben der Europäischen Kommission im Dokument "Guidelines. Evaluation of LEADER/CLLD", 2017, S. 10 und Kah, S.,"Update: Implementing cohesion policy funds through multi-Fund CLLD", 2021 (Daten korrekt mit Stand von Juni 2021).
15 Im Zeitraum 2021–2027 fallen LEADER und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung unter die Verordnung (EU) 2021/1060 mit gemeinsamen Bestimmungen. Für LEADER gelten neue Regeln zur Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP), die im Dezember 2021 in Kraft getreten sind9.
16 Wie in Ziffer 12 dargelegt, müssen die Mitgliedstaaten ihre Ansätze in Bezug auf LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung in ihren betreffenden Programmen beschreiben. Die Mitgliedstaaten haben damit begonnen, der Kommission ihre neuen operationellen Programme zur Genehmigung vorzulegen, und sie mussten ihre GAP-Strategiepläne einschließlich der LEADER-Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raums bis Ende 2021 vorlegen. Der Regelungsrahmen sieht die Förderung von Initiativen im Zusammenhang mit LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebener lokaler Entwicklung ab 2022 vor10. In der Zwischenzeit werden für LEADER nicht abgerufene Fördermittel aus dem vorangegangenen Zeitraum bereitgestellt.
Frühere Prüfungen
17 Der Hof stellte in seinem Jahresbericht zum Jahr 2000 Schwachstellen im Zusammenhang mit der Verwaltung von LEADER fest11. In einem Sonderbericht aus dem Jahr 201012 kam der Hof zu dem Schluss, dass lokale Aktionsgruppen zahlreiche Projekte umgesetzt hatten, die für Unternehmen und die Bevölkerung vor Ort von Nutzen waren. Schwachstellen wurden in folgenden Bereichen festgestellt:
- bei den Verfahren zur Projektauswahl, in denen die Entscheidungsfindung von Behörden dominiert wurde und die Regelungen zu potenziellen Interessenkonflikten unklar waren;
- bei der Anwendung des Bottom-up-Ansatzes, da einige lokale Aktionsgruppen das lokale Engagement nicht förderten;
- hinsichtlich der Fähigkeit lokaler Aktionsgruppen, lokale Lösungen zu entwickeln, die sich von herkömmlichen Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums unterschieden; beispielsweise wurden Projekte gefördert, die auch im Rahmen anderer Ausgabenprogramme hätten finanziert werden können;
- bei der Begleitung und Bewertung, insbesondere was den durch die Anwendung des LEADER-Ansatzes erzielten Nutzen betrifft.
18 2013 veröffentlichte der Hof eine Folgebewertung13, in der einige Verbesserungen festgestellt wurden. Dazu zählten klarere Vorschriften für die Entscheidungsgremien der lokalen Aktionsgruppen (siehe Ziffer 17 Punkt 1), jedoch waren die meisten Schwachstellen nach wie vor vorhanden. Eine aktualisierte Bewertung dieser Probleme findet sich in Anhang II.
Prüfungsumfang und Prüfungsansatz
19 Der LEADER-Ansatz zielt darauf ab, das lokale Engagement und die Einflussnahme der örtlichen Bevölkerung zu fördern (siehe Ziffer 03), was zusätzliche Kosten und Risiken mit sich bringt (siehe Ziffern 04–05). Diese Zusatzkosten und -risiken sind gerechtfertigt, wenn die zusätzlichen Nutzeffekte im Vergleich zu herkömmlichen (Top-down-)Ausgabenprogrammen der EU (insbesondere zum EU-Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums) überwiegen. Die Hauptprüfungsfrage lautete: "Hat der LEADER-Ansatz/die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung einen Nutzen erbracht, der die mit ihm/ihr verbundenen zusätzlichen Kosten und Risiken rechtfertigt?" Um dies zu bewerten, untersuchte der Hof, ob
- LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung das lokale Engagement förderten;
- LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung zu Projekten führten, die einen nachweisbaren Nutzen im Sinne einer verbesserten lokalen Governance, eines verbesserten Sozialkapitals und besserer Ergebnisse erbrachten;
- sich die Einführung des neuen Multifonds-Ansatzes in einer besseren Koordinierung der Unterstützung für die lokale Entwicklung niederschlug.
20 Diese Prüfung umfasst auch eine Weiterverfolgung einer früheren Prüfung des Hofes (siehe Ziffern 17–18), und es wird bewertet, ob die Kommission mehr als ein Jahrzehnt später gegen die ermittelten Schwachstellen vorgegangen ist. Der Hof beabsichtigt, der Kommission mit diesem Bericht Erkenntnisse sowie zeitnahe Empfehlungen für die laufende Bewertung des LEADER-Ansatzes an die Hand zu geben.
21 Abgedeckt wurde der Zeitraum 2014-2020. Der Hof untersuchte für diese Prüfung zehn Mitgliedstaaten, wobei in jedem Mitgliedstaat zwei lokale Aktionsgruppen einbezogen wurden. In Deutschland bezog sich die Prüfung auf Sachsen und in Portugal auf das Festland (d. h. Madeira und die Azoren wurden nicht berücksichtigt). Mit seiner Auswahl der Mitgliedstaaten zielte der Hof darauf ab, ein geografisches Gleichgewicht zu erreichen und sowohl den Monofonds- als auch den Multifonds-Ansatz sowie höhere und geringere Ausgaben für LEADER und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung zu erfassen (siehe Abbildung 4).
Abbildung 4 – Ausgewählte Mitgliedstaaten und Regionen sowie Förderansatz der ausgewählten LAG

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage einer Karte von Eurostat.
22 Die lokalen Aktionsgruppen wurden auf Grundlage der zugewiesenen Fördermittel, der Art der verwendeten EU-Fonds sowie des abgedeckten Gebiets und der abgedeckten Bevölkerung ausgewählt.
23 Der Hof untersuchte
- die Organisation und die Verfahren in allen ausgewählten Mitgliedstaaten und lokalen Aktionsgruppen ausgehend von Unterlagen und Antworten auf Prüfungsfragebögen;
- Informationen zu 95 Projekten, die ausgehend von ihren Kosten (niedrig, mittel, hoch), den betroffenen Sektoren und den genutzten EU-Fonds ausgewählt wurden. Die Gesamtkosten dieser Projekte belaufen sich auf 7,5 Millionen Euro, wobei die EU-Mittel 4,9 Millionen Euro betragen (siehe Anhang III);
- Tätigkeiten der Kommission im Zusammenhang mit LEADER und der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung anhand von Aktenprüfungen und Videokonferenzen mit
- den vier zuständigen Generaldirektionen (Landwirtschaft und ländliche Entwicklung (GD AGRI), Beschäftigung, Soziales und Integration (GD EMPL), Maritime Angelegenheiten und Fischerei (GD MARE) und Regionalpolitik und Stadtentwicklung (GD REGIO)),
- den Behörden der Mitgliedstaaten,
- den Vertretern lokaler Aktionsgruppen,
- den Projektträgern und
- Interessenverbänden und internationalen Experten.
Bemerkungen
Lokale Aktionsgruppen fördern lokales Engagement, bringen jedoch zusätzliche Kosten und langsame Genehmigungsverfahren mit sich
24 In den folgenden Abschnitten wird erörtert, wie die Mitgliedstaaten und lokale Aktionsgruppen das lokale Engagement förderten und welche Kosten dies verursachte. Der Hof beginnt mit einer Analyse der im Rahmen von LEADER angefallenen Kosten. Danach untersucht er, wie die Mitgliedstaaten die lokalen Aktionsgruppen und ihre Strategien genehmigten und wie in der Folge lokale Aktionsgruppen LEADER-Projekte auswählten.
Lokale Aktionsgruppen bringen zusätzliche Kosten mit sich
25 Wie in der Einleitung dargelegt, sind lokale Aktionsgruppen das Herzstück von LEADER und der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung. Sie können für unterschiedliche Zwecke eine EU-Förderung erhalten (siehe Abbildung 5). Mitgliedstaaten, Regionen, lokale Aktionsgruppen und Projektträger müssen auch einen Beitrag zur Finanzierung leisten.
26 Die Mitgliedstaaten sollten die passenden Voraussetzungen für lokale Aktionsgruppen schaffen, damit diese ihre Aufgaben erfüllen können. Insbesondere sollten sie unterschiedliche lokale Interessenträger zusammenbringen und sie bei der Entwicklung von Projekten unterstützen, die für die lokale Entwicklung förderlich sind. Zu diesem Zwecke sollten sie lokale Aktionsgruppen selbständig agieren lassen und deren Verwaltungsaufwand auf ein Mindestmaß beschränken14.
Abbildung 5 – Geplante EU-Mittel für LEADER und die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung (2014–2020; in Milliarden Euro)

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission.
27 Der partizipative Ansatz von LEADER bedingt zusätzliche Verwaltungsstrukturen und Tätigkeiten zur Unterstützung der lokalen Entwicklungsstrategie, wodurch zusätzliche Kosten entstehen. Diese Verwaltungs- und Betriebskosten werden durch die Verordnung auf 25 % begrenzt (siehe Ziffer 05). Einige Mitgliedstaaten habe diese Grenze auf 20 % gesenkt.
28 Tabelle 2 bietet einen Überblick über die geplanten und ausgezahlten LEADER-Fördermittel (mit Stand von Ende 2020) für den Programmplanungszeitraum 2014–2020. Daraus ist ersichtlich, dass die Mitgliedstaaten Ausgaben in Höhe von 17 % für die Verwaltungs- und Betriebskosten der lokalen Aktionsgruppen vorsahen. Dies liegt klar im Bereich der durch die EU-Rechtsvorschriften festgelegten Grenzen.
| Kostenart | Geplante LEADER-Fördermittel (2014–2020) | Gemeldete LEADER-Ausgaben (bis Ende 2020) | ||
|---|---|---|---|---|
| Millionen Euro | % der geplanten LEADER-Mittel insgesamt | Millionen Euro | % der ausgezahlten LEADER-Mittel insgesamt | |
| Vorbereitungskosten | 81,6 | 1 % | 67,4 | 2 % |
| Verwaltungs- und Betriebskosten | 1 673,6 | 17 % | 1 038 | 24 % |
| Kooperationsmaßnahmen | 380,9 | 4 % | 98,6 | 2 % |
| Projektkosten | 7 794,2 | 78 % | 3 054,4 | 72 % |
| Insgesamt (alle Mitgliedstaaten sowie das Vereinigte Königreich) | 9 930,2 | 100 % | 4 258,4 | 100 % |
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission.
29 Laut der Kommission beliefen sich Ende 2020 die Kosten für Projekte der lokalen Gemeinschaften auf 3,1 Milliarden Euro bzw. 72 % der gemeldeten LEADER-Ausgaben. Insgesamt entfiel ein geringer Anteil der Ausgaben der lokalen Aktionsgruppen auf Kooperationsmaßnahmen (2 %) und Vorbereitungskosten (2 %). Die Verwaltungs- und Betriebskosten der lokalen Aktionsgruppen beliefen sich auf 1,04 Milliarden Euro (24 % der Gesamtausgaben zu diesem Zeitpunkt). In mehreren Mitgliedstaaten, in denen die gemeldeten Ausgaben für LEADER-Projekte gering waren, waren diese Kosten hoch. Beispielsweise entsprachen sie in Griechenland, Portugal und der Slowakei Ende 2020 etwa dem für Projekte ausgegebenen Betrag oder überstiegen diesen. Zahlungen für den Zeitraum 2014–2020 können bis Ende 2023 erfolgen; der Anteil der Verwaltungsausgaben nimmt im Vergleich zu den Projektausgaben während des Programmplanungszyklus tendenziell ab.
30 In Tabelle 3 sind die gemeldeten Ausgaben nach den 10 ausgewählten Mitgliedstaaten und Regionen aufgeschlüsselt. In Abbildung 6 werden sie mit den geplanten Gesamtmitteln für LEADER verglichen. Im Durchschnitt hatten die Mitgliedstaaten 39 % ihrer geplanten LEADER-Projektmittel als ausgezahlt gemeldet. Estland hatte 72 % seiner geplanten Projektmittel ausgezahlt, Griechenland 13 %, und die Slowakei hatte noch für kein Projekt Auszahlungen getätigt.
Tabelle 3 – Gemeldete LEADER-Ausgaben nach Kostenart (Millionen Euro, Stand Ende 2020)
| Mitgliedstaat/Region | Vorbereitungs-kosten | Verwaltungs-kosten | Kooperations-maßnahmen | Projektkosten | Insgesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| Tschechien | - | -* | 0,2 | 64,5 | 64,7 |
| Deutschland (Sachsen) | - | 19,4 | 2,5 | 200,5 | 222,4 |
| Estland | 1,6 | 12,5 | 2,3 | 48,8 | 65,2 |
| Irland | 1,3 | 44,3 | 0,8 | 77,6 | 124,0 |
| Griechenland | 3,2 | 43,1 | 0,2 | 46,4 | 92,9 |
| Österreich | - | 33,8 | 8,0 | 68,7 | 110,5 |
| Portugal (Festland) | 1,4 | 36,0 | 0,5 | 36,0 | 73,9 |
| Rumänien | 2,0 | 77,3 | 0,1 | 268,4 | 347,8 |
| Slowakei | 1,1 | 0,4 | 0 | 0 | 1,5 |
| Schweden | 3,4 | 28,3 | 3,2 | 63,0 | 97,9 |
| Ausgewählte Mitgliedstaaten/Regionen | 14,0 | 295,1 | 17,8 | 873,9 | 1 200,8 |
| Alle Mitgliedstaaten (sowie das Vereinigte Königreich) | 67,4 | 1 038,0 | 98,6 | 3 054,4 | 4 258,4 |
* In obiger Tabelle ist für Tschechien kein Betrag für die Verwaltungskosten angeführt, da diese durch den Fonds für regionale Entwicklung (federführender Fonds in Tschechien) und nicht durch den Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums gedeckt werden.
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission.
Abbildung 6 – Gemeldete LEADER-Ausgaben für die Entwicklung des ländlichen Raums für die ausgewählten Mitgliedstaaten und Regionen (Stand Ende 2020)

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Daten der Europäischen Kommission.
Die meisten Mitgliedstaaten wendeten geeignete Verfahren für die Genehmigung lokaler Aktionsgruppen an, einige wendeten bei der Auswahl lokaler Entwicklungsstrategien jedoch keine Mindestqualitätsanforderungen an
31 Die Mitgliedstaaten sollten lokale Aktionsgruppen bei der Festlegung ihrer lokalen Entwicklungsstrategien sowohl finanziell (vorbereitende Unterstützung) als auch durch klare Qualitätsanforderungen und Leitlinien unterstützen. In der Folge sollten sie die lokalen Aktionsgruppen auf faire und transparente Art und Weise im vorgegebenen Zeitrahmen bewerten und nur jene genehmigen, die den Qualitätsstandards entsprechende Strategien vorlegen.
32 Die lokalen Aktionsgruppen sollten ihre lokalen Gemeinschaften durch eine Kombination mehrerer Methoden wie Schulungsveranstaltungen, Workshops oder Seminare in ihren Strategieentwicklungsprozess einbinden und dazu ihr Wissen über das lokale Gebiet nutzen. Im vorangegangenen LEADER-Sonderbericht ermittelte der Hof Schwachstellen in Bezug auf die Art und Weise, wie lokale Aktionsgruppen das lokale Engagement förderten. Diesmal stellte der Hof fest, dass alle ausgewählten lokalen Aktionsgruppen solche Tätigkeiten durchgeführt und ihre lokalen Entwicklungsstrategien mittels eines Bottom-up-Verfahrens entwickelt hatten.
33 Die Mitgliedstaaten mussten Kriterien für die Genehmigung lokaler Aktionsgruppen definieren und die vorgeschlagenen Strategien anhand dieser Kriterien bewerten. Das Verfahren beinhaltete eine Interessenbekundung bzw. mehrere Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen, die Erstellung von Strategieentwürfen, die Bewertung der Strategien durch die Mitgliedstaaten und, sofern nötig, deren Überarbeitung. Die Mitgliedstaaten mussten bis Ende 2017 (zwei Jahre nachdem in anderen Bereichen der Gemeinsamen Agrarpolitik die Auszahlung von Fördermitteln begann) die Strategien auswählen und die lokalen Aktionsgruppen genehmigen15. Die meisten Mitgliedstaaten schafften dies im Jahr 2016, Irland und Tschechien benötigten mehr Zeit, und die Slowakei schloss das Genehmigungsverfahren im März 2018 ab (siehe Abbildung 7 und Kasten 1).
34 Der Hof stellte fest, dass die Mitgliedstaaten das Genehmigungsverfahren durch Workshops, Schulungsveranstaltungen und Übungen zum Kapazitätsaufbau für lokale Aktionsgruppen im Großen und Ganzen gut unterstützt und überwacht hatten. Einige Verwaltungsbehörden boten der lokalen Bevölkerung Orientierung in Form von Informationsmaterial oder eines Handbuchs oder richteten Kontaktstellen ein, an die Fragen gerichtet werden konnten.
Abbildung 7 – Dauer des Verfahrens zur Genehmigung lokaler Aktionsgruppen in den 10 ausgewählten Mitgliedstaaten

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von in den Mitgliedstaaten eingeholten Informationen. "Relative Frist": Die erste Runde für die Auswahl der Strategie und LAG sollte zwei Jahre nach der Genehmigung ihrer Partnerschaftsvereinbarung abgeschlossen sein. "Absolute Frist" (rote Linie): Die Genehmigung der lokalen Entwicklungsstrategie sollte bis 31.12.2017 abgeschlossen sein. (Artikel 33 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013)
Lange Entwicklungsdauer für die lokalen Strategien in der Slowakei
Die Ausarbeitung lokaler Entwicklungsstrategien in der Slowakei dauerte zweieinhalb Jahre und war drei Monate nach Ablauf der auf Dezember 2017 festgesetzten Frist abgeschlossen.
Zum Zeitpunkt der Prüfung des Hofes drei Jahre später waren noch keine Projekte finanziert worden.
Die Kommission war sich des langwierigen Verfahrens bewusst und forderte Maßnahmen, um dieses zu beschleunigen.
35 Die Kommission hatte empfohlen, dass die Mitgliedstaaten die lokalen Entwicklungsstrategien auf der Grundlage von Qualitätsstandards bewerten und miteinander vergleichen16. Mit diesem Ansatz wollte die Kommission sicherstellen, dass jene lokalen Aktionsgruppen ausgewählt werden, deren Strategien Mindestqualitätsanforderungen genügen.
36 Die Mitgliedstaaten mussten Bewertungskriterien für die Auswahl der lokalen Entwicklungsstrategien definieren. Dazu zählte die Definition von Qualitätsstandards, die alle Strategien zu erfüllen hatten17. Der Hof stellte fest, dass neun Mitgliedstaaten Qualitätsstandards definiert hatten, jedoch waren diese in Tschechien, Griechenland und der Slowakei weniger strikt. Rumänien legte keine Qualitätsstandards fest.
37 Tabelle 4 bietet für jeden von der Prüfung erfassten Mitgliedstaat einen Überblick über die Anzahl der vorgelegten und ausgewählten Strategien. Sechs Mitgliedstaaten wählten alle lokalen Aktionsgruppen aus, die Strategien vorlegten. Rumänien verdoppelte die Anzahl der ursprünglich geplanten lokalen Aktionsgruppen (von 120 auf 239).
Tabelle 4 – Auswahl lokaler Aktionsgruppen/lokaler Entwicklungsstrategien
| Mitgliedstaat | Anzahl vorgelegter Strategien | Anzahl ausgewählter Strategien |
|---|---|---|
| Tschechien | 179 | 178 |
| Deutschland (Sachsen) | 350 | 350 |
| Estland | 34 | 34 |
| Irland | 30 | 30 |
| Griechenland | 50 | 50 |
| Österreich | 77 | 77 |
| Portugal | 175 | 92 |
| Rumänien | 239 | 239 |
| Slowakei | 121 | 110 |
| Schweden | 53 | 48 |
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von in den ausgewählten Mitgliedstaaten eingeholten Daten.
Die Genehmigung von Projekten durch die lokalen Aktionsgruppen dauerte länger als erwartet
38 Um Projekte auszuwählen, die sich vorteilhaft auf die lokale Entwicklung auswirken, sollten lokale Aktionsgruppen Kriterien festlegen, die für ihr lokales Gebiet geeignet sind, und faire und transparente Verfahren anwenden. Unterstützung im Rahmen von LEADER und für die von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung ist möglich für
- Projekte der lokalen Gemeinschaften,
- Kooperationsmaßnahmen zwischen zwei oder mehreren lokalen Aktionsgruppen aus demselben Mitgliedstaat oder unterschiedlichen Ländern (EU- und Nicht-EU-Länder).
39 Sieben von zehn Mitgliedstaaten nutzten Online-Anträge, vereinfachte Kostenoptionen oder andere Möglichkeiten, um das Auswahlverfahren zu erleichtern. In vier Mitgliedstaaten (Griechenland, Portugal, Tschechien und Slowakei) war das Verfahren zur Projektbeantragung und -genehmigung besonders kompliziert und zeitaufwändig.
40 Das Verfahren bestand aus bis zu acht Schritten und dauerte im Durchschnitt ein Jahr, in Extremfällen auch mehr als zwei Jahre. Die Antragsteller mussten sich zuerst bei der lokalen Aktionsgruppe bewerben, die die Förderfähigkeit und die Übereinstimmung des Projekts mit der lokalen Entwicklungsstrategie prüfte. Danach reichten sie den Antrag bei den zuständigen Behörden ein. In Griechenland mussten die Antragsteller ihre Anträge sowohl elektronisch als auch in Papierform einreichen. Diese zusätzlichen administrativen Anforderungen trugen dazu bei, dass die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Prüfung nur relativ wenige Projekte abgeschlossen und dafür Zahlungen geleistet hatten (39 % der geplanten LEADER-Projektausgaben).
41 Laut dem Leitfaden der Kommission sollten lokale Entwicklungsstrategien lokalen Zwecken dienen, und die ausgewählten Projekte sollten zur Erreichung der Strategieziele beitragen18. Die lokalen Aktionsgruppen legten in ihren lokalen Entwicklungsstrategien eher allgemeine Ziele und Projektauswahlkriterien fest. Dadurch konnten die lokalen Aktionsgruppen viele unterschiedliche Projekte auswählen.
Der LEADER-Ansatz fördert das lokale Engagement, Frauen und junge Menschen sind in den lokalen Aktionsgruppen jedoch unterrepräsentiert
42 Lokale Aktionsgruppen stellen im Hinblick auf die Gestaltung und Ausführung lokaler Entwicklungsstrategien ein Forum für die Kommunikation innerhalb der örtlichen Bevölkerung dar, da sie lokale Projekte initiieren, entwickeln und finanzieren. Sie helfen, die örtliche Bevölkerung zusammenzubringen und in die lokale Entwicklung einzubinden. Durch den LEADER-Ansatz werden das Wissen und die Erfahrung der örtlichen Bevölkerung im Hinblick auf die Ermittlung ihres Entwicklungsbedarfs genutzt. Dieser Ansatz wurde auch entwickelt, um eine Plattform für den Austausch zwischen unterschiedlichen Regierungsebenen, von der Gemeinde- über die regionale bis zur nationalen Ebene, zu bieten und Anreize für eine engere Zusammenarbeit zu schaffen.
43 Lokale Aktionsgruppen sollten für die örtliche Bevölkerung repräsentativ sein und alle maßgeblichen lokalen Interessenträger einbinden. Gemäß den Rechtsvorschriften darf keine einzelne Interessengruppe mit mehr als 49 % der Stimmrechte einer lokalen Aktionsgruppe vertreten sein, und im Projektauswahlverfahren muss der Stimmenanteil öffentlicher Behörden weniger als 50 % betragen19. Laut dem Leitfaden der Kommission sollten die Entscheidungsgremien ein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen aufweisen, und spezielle Zielgruppen wie junge Menschen, ethnische Minderheiten und benachteiligte Personen sollten gerecht vertreten sein20.
44 Der Hof stellte fest, dass die von ihm untersuchten lokalen Aktionsgruppen ein Forum für die Kommunikation auf lokaler Ebene darstellten und die rechtlichen Anforderungen in Bezug auf die Zusammensetzung der Entscheidungsgremien der Gruppen erfüllten. Das bedeutet, dass das Verfahren nicht mehr von Behörden dominiert wurde (wie der Hof 2010 festgestellt hatte). Aus der Analyse des Hofes ging hervor, dass in 10 von 18 lokalen Aktionsgruppen, von denen der Hof Daten erhielt, Männer mindestens 60 % der Positionen einnahmen. Junge Menschen waren unterrepräsentiert. 16 von 20 der vom Hof untersuchten lokalen Aktionsgruppen hatten keine Mitglieder unter 30 Jahren in ihren Entscheidungsgremien21. Dadurch entsteht das Risiko, dass die Ansichten und Interessen von Frauen und jungen Menschen von den Entscheidungsgremien bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt werden.
Zusätzlicher Nutzen von LEADER und der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung noch immer nicht nachgewiesen
45 In seinem vorherigen Sonderbericht zu LEADER kam der Hof zu dem Schluss, dass es nur unzureichende Belege für den Mehrwert des LEADER-Ansatzes gab, und empfahl der Kommission, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um in der Lage zu sein, Rechenschaft über den Mehrwert und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung im Zusammenhang mit LEADER abzulegen. Wie in Ziffer 07 erwähnt, erwartet die Kommission, dass der LEADER-Ansatz zu besseren Projektergebnissen, einem verbessertem Sozialkapital und einer verbesserten lokalen Governance führt.
46 In den folgenden Abschnitten werden diese Aspekte nacheinander betrachtet, wobei zuerst untersucht wird, ob die Kommission im vergangenen Jahrzehnt Fortschritte bei der Erfassung des Nutzens von LEADER erzielt hat. Danach untersucht der Hof, ob die lokalen Entwicklungsprojekte im Rahmen von LEADER bessere Ergebnisse erbrachten, und schließlich, ob es Belege dafür gibt, dass der LEADER-Ansatz zu einem verbessertem Sozialkapital und einer verbesserten Governance in den lokalen Gemeinschaften führt.
Die Kommission hat mit der Bewertung des Nutzens von LEADER begonnen
47 Die Untersuchung des einschlägigen Begleitungs- und Bewertungssystems durch den Hof ergab, dass eine zentrale Empfehlung aus dem LEADER-Sonderbericht von 2010 zur Rechenschaft über den Nutzen von LEADER nicht vollständig umgesetzt wurde (siehe Ziffer 17 und Anhang II).
48 Wie in Ziffer 13 erläutert, überwacht die Kommission die Ergebnisse des LEADER-Programms und berichtet darüber anhand von drei Indikatoren, die in der Verordnung festgelegt sind. Tabelle 5 sind jene Daten zu LEADER zu entnehmen, die im jährlichen Tätigkeitsbericht 2019 der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung angeführt sind.
| Indikator | Ziel (für 2023) | Gemeldete Daten |
|---|---|---|
| % der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstrategien gelten | 53,5 % | 60,6 % |
| % der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen profitiert | 16,4 % | 13,54 % |
| Anzahl der durch unterstützte Projekte geschaffenen Arbeitsplätze | 44 109 | 13 337 |
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des jährlichen Tätigkeitsberichts 2019 der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.
49 Diese Indikatoren ermöglichen keine aussagekräftige Bewertung der Kosten und des Nutzens des LEADER-Ansatzes. So hat der Hof in seinen vorangegangenen Berichten, auch in seinem Leistungsbericht 201922, festgestellt, dass es sich bei den verwendeten Indikatoren überwiegend um Input- und Outputindikatoren handelt, mit denen weder Ergebnisse noch der Mehrwert der Ausgabenprogramme gemessen werden. Im LEADER-Bericht von 2010 empfahl der Hof der Kommission, dringend Maßnahmen zu ergreifen, um in der Lage zu sein, Rechenschaft über den Nutzen des LEADER-Ansatzes abzulegen, und bei der Begleitung den Schwerpunkt auf Indikatoren für einen solchen Nutzen sowie für Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit zu legen, nicht für Umsetzung.
50 Gemäß den Rechtsvorschriften muss die Kommission den Mitgliedstaaten Leitlinien für die Bewertung ihrer Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum und ihrer operationellen Programme an die Hand geben. Die Programmbewertungen am Ende des Zeitraums – die Ex-post-Bewertungen – werden von der Kommission oder den Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit der Kommission ausgeführt23.
51 Die Kommission hat zwei Leitliniendokumente herausgegeben, um die Mitgliedstaaten bei der Bewertung von LEADER und der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung im Programmplanungszeitraum 2014–2020 zu unterstützen: Bewertungsleitlinien24 und ein Bewertungshandbuch25. Die Kommission muss auch einen Synthesebericht über die Ex-Post-Bewertungen der Mitgliedstaaten vorlegen: bis zum 31. Dezember 2025 für die operationellen Programme und bis zum 31. Dezember 2027 für die Entwicklungsprogramme für den ländlichen Raum26.
52 Im Programmplanungszeitraum 2007–2013 musste die Kommission den Synthesebericht für die Entwicklung im ländlichen Raum bis 31. Dezember 2016 vorlegen27. Dieser Bericht wurde im April 2018 abgeschlossen und im Juli 2020 veröffentlicht28. Er enthielt einen kurzen Abschnitt über LEADER, jedoch keine Bewertung des Nutzens von LEADER.
53 Die Kommission hat ihre eigene Bewertung des LEADER-Ansatzes noch nicht veröffentlicht. In seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2018 zu den Vorschlägen der Kommission für die neue Gemeinsame Agrarpolitik empfahl der Hof der Kommission, bei der Überarbeitung von Rechtsvorschriften den Grundsatz der vorherigen Evaluierung zu beachten29. Die Kommission nimmt derzeit eine Bewertung der Auswirkungen des Teils des LEADER-Ansatzes, der aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums finanziert wird, auf eine ausgewogene räumliche Entwicklung vor. Mit dieser Bewertung sollen die Zweckdienlichkeit, Wirksamkeit, Effizienz, Kohärenz und der Mehrwert untersucht werden30. Die Kommission beabsichtigt, diese Bewertung 2023 zu veröffentlichen.
Die Mitgliedstaaten verwendeten LEADER zur Förderung von Projekten, die aus den lokalen Strategien abgeleitet waren, für einige existierten jedoch andere spezifische Ausgabenprogramme
54 In Ermangelung einer Bewertung durch die Kommission oder einschlägiger Begleitungsdaten zur Erfassung des Nutzens von LEADER-Projekten bewertete der Hof, ob Projekte im Rahmen von LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebener lokaler Entwicklung über das Potenzial verfügten, zur lokalen Entwicklung beizutragen und bessere Ergebnisse zu liefern. Dazu analysierte der Hof, ob die Projekte von den durch die lokalen Aktionsgruppen ausgearbeiteten lokalen Entwicklungsstrategien abgeleitet waren (siehe Ziffer 41) und somit über das Potenzial verfügten, auf lokale Bedürfnisse zu reagieren. Der Hof verwendete außerdem die Bewertungsleitlinien der Kommission, in denen bessere Ergebnisse in Bezug auf die Projektarten im Vergleich zu einer Durchführung ohne die LEADER-Methode definiert werden31.
55 Der Hof bewertete 95 Projekte nach diesen in Ziffer 54 vorgestellten Kriterien. Grundlage dafür waren Selbstbewertungen durch die lokalen Aktionsgruppen. Der Hof untersuchte die Plausibilität dieser Selbstbewertungen und diskutierte seine Beurteilung mit den Behörden und einigen Projektträgern.
56 Er stellte fest, dass sich diese Projekte an den in den lokalen Entwicklungsstrategien festgelegten, breit gefassten allgemeinen Zielen orientierten (siehe Ziffer 41). Einige Projekte verfügten über das Potenzial, zur lokalen Entwicklung beizutragen. Der Hof stieß auch auf Projekte, die gesetzliche Aufgaben ergänzten und nicht durch spezifische Programme abgedeckt waren.
57 Nichtsdestoweniger stellte der Hof fest, dass einige von seiner Prüfung erfasste Mitgliedstaaten Fördermittel im Rahmen von LEADER oder von der örtlichen Bevölkerung betriebener lokaler Entwicklung zur Finanzierung von Projekten nutzen, die zu den typischen gesetzlichen Aufgaben von Behörden auf nationaler, regionaler oder Gemeindeebene zählen (wie die Finanzierung von Gemeindestraßen oder Straßenbeleuchtung). Außerdem stieß der Hof auf Projekte, die in spezifischer Weise Gegenstand von Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums außerhalb von LEADER sowie anderer EU-Ausgabenprogramme sind (siehe Kasten 2).
58 Beispielsweise wurde LEADER in Deutschland (Sachsen) zur Finanzierung eines breiten Spektrums ländlicher Dienstleistungen genutzt. Hier wurden 364,3 Millionen Euro bzw. 41,5 % der geplanten Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raums LEADER zugewiesen. Dies ist der größte Anteil unter allen Mitgliedstaaten und Regionen der EU. Herkömmliche Gemeindeaufgaben mussten in Deutschland (Sachsen) daher über lokale Aktionsgruppen laufen. Dazu zählten die Finanzierung von Ortsstraßen, Straßenbeleuchtung und -erhaltung und Projekte zur Erweiterung von Kindertageseinrichtungen. Laut dem Bericht über die Halbzeitbewertung zur Entwicklung des ländlichen Raums wurden in Sachsen bis zum 30. Juni 2019 LEADER-Mittel zur Finanzierung von 112 Straßenbeleuchtungsprojekten (im Wert von 5,5 Millionen Euro an öffentlichen Ausgaben), 84 Ortsstraßen (13 Millionen Euro) und 62 Kindertageseinrichtungsprojekten (6,3 Millionen Euro) verwendet32.
Durch LEADER geförderte Projekte, für die andere spezifische Maßnahmen und Ausgabenprogramme existierten
Tschechien und Rumänien: Unterstützung für die Modernisierung landwirtschaftlicher Betriebe und für Junglandwirte
![]() ELER
ELER
Eine einzige lokale Aktionsgruppe in Rumänien wählte 10 Investitionsprojekte für landwirtschaftliche Betriebe mit Gesamtkosten von 1,7 Millionen Euro aus. Diese Projekte machten mehr als die Hälfte der Gesamtkosten aller ausgewählten Projekte aus. Die zweite rumänische Gruppe zahlte Junglandwirten in acht Fällen einen Pauschalbetrag von insgesamt 240 000 Euro als Unterstützung aus. Alle Mitgliedstaaten verfügen über spezifische Maßnahmen zur Unterstützung von Junglandwirten im Rahmen von Säule I der GAP, und Rumänien stellt im Rahmen von Säule II spezifische Unterstützung bereit.
Die zwei lokalen Aktionsgruppen in Tschechien wählten 47 Investitionsprojekte für landwirtschaftliche Betriebe mit Kosten von rund 2 Millionen Euro aus, was beinahe der Hälfte der Gesamtkosten aller ausgewählten Projekte entspricht. Eine dieser lokalen Aktionsgruppen gab rund 80 % ihrer gesamten Projektkosten für landwirtschaftliche Projekte aus.
Im Rahmen dieser Projekte wurde Landwirten EU-Förderung vorwiegend für Investitionen in neue Ställe und Ausrüstung gewährt, oder Junglandwirte wurden damit bei der Betriebsgründung unterstützt.
Interessierte Landwirte können außerhalb von LEADER Fördermittel für die Entwicklung des ländlichen Raums beantragen, sodass die Verwendung von LEADER-Mitteln in solchen Fällen eine Überschneidung mit bestehenden Programmen darstellt.
59 Eine derartige Situation stellte der Hof 2010 fest. Damals stimmte die Kommission zu, dass LEADER grundsätzlich keine herkömmlichen Maßnahmen der Kommunalverwaltungen fördern sollte. Im Sonderbericht des Hofes von 2015 zur EU-Infrastrukturförderung im ländlichen Raum33 stellte der Hof eine ähnliche Situation bei der Finanzierung von Landstraßen in Deutschland (Sachsen) fest und empfahl, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass die EU-Mittel für die Entwicklung des ländlichen Raums nicht andere für denselben Politikbereich bestimmte öffentliche Mittel ersetzen.
60 In Irland und Schweden stellte der Hof fest, dass dies durch die Förderfähigkeitsregelungen dieser Länder größtenteils vermieden wurde:
- Die irischen Behörden schlossen eine Reihe von Sektoren und Aktivitäten, für die andere Fördermöglichkeiten bestanden, vom Erhalt von LEADER-Mitteln aus, darunter die Landwirtschaft, die Renovierung privater Wohnimmobilien, allgemeine Instandhaltungsarbeiten durch öffentliche Stellen sowie Projekte, die bereits andere EU- oder nationale Förderungen erhielten.
- In Schweden gab es Regelungen, die untersagten, Fördermittel für die Deckung der Kosten gesetzlicher Aufgaben oder zur Erfüllung rechtlicher Anforderungen seitens der EU (z. B. zur Erfüllung einer EU-Richtlinie) oder des Staates zu verwenden. Außerdem war vorgeschrieben, dass von Projekten im Rahmen von LEADER und von der örtlichen Bevölkerung betriebener lokaler Entwicklung die lokale Gemeinschaft im weiteren Sinne profitieren musste, nicht nur individuelle Projektträger.
Wenngleich die Umstände in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedlich sind, handelt es sich bei diesen Vorschriften nach Ansicht des Hofes um empfehlenswerte Verfahren, die einen Beitrag zur wirtschaftlichen Haushaltsführung im Rahmen des LEADER-Programms leisten könnten.
Während Experten es als schwierig erachten, einige potenzielle Nutzeffekte des LEADER-Ansatzes zu bewerten, fand der Hof auch Belege dafür, dass dies möglich wäre
61 Neben besseren Projektergebnissen definiert die Kommission den Nutzen von LEADER auch über ein verbessertes Sozialkapital und eine verbesserte Governance. Die Bewertungsleitlinien der Kommission enthalten folgende Definitionen:
- Sozialkapital ist ein multidimensionales Konzept, zu dem Merkmale sozialer Organisationen wie Netzwerke, Normen und soziales Vertrauen zählen, die Koordination und Kooperation zum gegenseitigen Vorteil erleichtern.
- Governance umfasst die Einrichtungen, Vorgänge und Mechanismen, durch die öffentliche, wirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Interessenträger ihre Interessen artikulieren, ihre gesetzlichen Rechte ausüben, ihre Verpflichtungen erfüllen und ihre Streitigkeiten beilegen.
62 Aus der Fachliteratur geht hervor, dass die Messung der Verbesserung des Sozialkapitals und der lokalen Governance verschiedene Herausforderungen mit sich bringt. Dazu zählt auch eine allgemein akzeptierte Definition dieser Konzepte34. Experten erkennen daher an, dass eine Bewertung des potenziellen Nutzens von LEADER schwierig ist.
63 Zusätzlich zum Synthesebericht der Kommission (siehe Ziffer 52) analysierte der Hof Ex-post-Bewertungsberichte der von der Prüfung erfassten Mitgliedstaaten, vor allem aus dem Zeitraum 2007–2013, im Hinblick auf Belege für ein verbessertes Sozialkapital und eine verbesserte lokale Governance. Die meisten Ex-post-Berichte der Mitgliedstaaten bezogen sich nicht auf diese Konzepte. Die schwedische Ex-post-Bewertung 2007–2013 enthielt Feststellungen, die sich ausdrücklich auf die lokale Governance bezogen. Nach Ansicht der Bewerter leistete LEADER keinen positiven Beitrag zur "vertikalen Governance", d. h. zum Status der lokalen Aktionsgruppen im Verhältnis zu den anderen Behörden und Institutionen. Was die "horizontale Governance" betrifft, also die Zusammenarbeit mit anderen regionalen Interessenträgern, betonten die Bewerter, dass LEADER zu einer Beteiligung von Vertretern lokaler Unternehmen und der Zivilgesellschaft an lokalen öffentlichen Angelegenheiten geführt habe.
Der Multifonds-Ansatz macht die Förderung lokaler Entwicklungsprojekte komplexer
64 Die europäischen Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds) umfassen fünf verschiedene Finanzierungsquellen, jeweils mit eigenen spezifischen Regelungen (siehe Ziffer 10). Dies macht eine Koordinierung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten erforderlich, um Synergieeffekte zu erzielen und Überschneidungen auf Programm- und Projektebene zu vermeiden. Die Rechtsvorschriften für den Programmplanungszeitraum 2014–2020 gehen speziell auf diesen Koordinierungsbedarf ein35.
65 Laut der Kommission ist die Einrichtung gemeinsamer Begleitausschüsse für die verschiedenen Programme sinnvoll und praktisch. Der Hof stellte fest, dass nur vier der 10 geprüften Mitgliedstaaten solche Ausschüsse eingerichtet hatten.
66 Die Mitgliedstaaten fanden jedoch andere Lösungen, um den Informationsfluss zu erleichtern. In Österreich und Deutschland (Sachsen) waren die Verwaltungsbehörden der einzelnen Fonds in den Begleitausschüssen aller anderen Fonds vertreten. Estland hatte eine gemeinsame Verwaltungsbehörde für den Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Fischereifonds eingerichtet.
67 Die Planung betreffend die zwei Finanzierungsquellen der Gemeinsamen Agrarpolitik (Europäischer Garantiefonds für die Landwirtschaft und Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) wird zukünftig im Rahmen von GAP-Strategieplänen stattfinden, die Teil der Reform nach 2020 sind. Deshalb wird die Entwicklung des ländlichen Raums möglicherweise weniger stark mit den anderen drei Finanzierungsquellen (Europäischer Fonds für regionale Entwicklung, Europäischer Sozialfonds Plus und Europäischer Meeres-, Fischerei- und Aquakulturfonds) verknüpft sein.
68 Die Kommission erwartete vom Multifonds-Ansatz eine Erweiterung der Palette lokaler Sektoren, Interessengruppen und Projektträger, die sich an lokalen Aktionsgruppen beteiligen, und somit eine Stärkung der lokalen Zusammenarbeit. Sie erwartete außerdem, dass die Einbeziehung von vier EU-Fonds lokale Aktionsgruppen in die Lage versetzen würde, komplexe lokale Bedürfnisse umfassender und mit mehr Finanzmitteln anzugehen.
69 Die Kommission hat noch keine umfassenden Angaben zur Gesamtzahl der lokalen Arbeitsgruppen, die den Multifonds-Ansatz nutzen, gemacht. Laut den neuesten Datenzusammenstellungen36 wurden im Programmplanungszeitraum 2014–2020 von allen Mitgliedstaaten (einschließlich des Vereinigten Königreichs) insgesamt 3 337 Gruppen genehmigt. Von diesen nutzten 813 (24 %) mehr als einen EU-Fonds (siehe Abbildung 8). Die meisten dieser durch mehrere Fonds geförderten lokalen Aktionsgruppen kombinierten Mittel aus dem Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums, dem Fonds für regionale Entwicklung und dem Sozialfonds, während neun in der gesamten EU (acht in Schweden und eine in Polen) alle vier verfügbaren Fonds nutzten.
Abbildung 8 – Lokale Aktionsgruppen mit Mono- bzw. Multifonds-Förderung im Zeitraum 2014–2020

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Kah, S., Update: Implementing cohesion policy funds through multi-Fund CLLD, 2021 (Daten korrekt mit Stand von Juni 2021).
70 Der Multifonds-Ansatz war für die lokalen Aktionsgruppen und die Behörden der Mitgliedstaaten neu, und die lokalen Aktionsgruppen setzten sich zum ersten Mal mit dem Sozial- und dem Regionalfonds auseinander. Im Leitfaden der Kommission37 wurde daher der Bedarf an einer "klaren Festlegung von Zuständigkeitsbereichen und Entscheidungsbefugnissen" betont. Dies erforderte eine Koordinierung zwischen den zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, nicht zuletzt, um den lokalen Aktionsgruppen klare Regeln und Leitlinien – idealerweise durch eine einzige Kontaktstelle – zur Verfügung zu stellen.
71 Von den im Rahmen dieser Prüfung abgedeckten Mitgliedstaaten verfügte Schweden über die einfachsten Verfahren zur Verwaltung des Multifonds-Ansatzes. Schweden hatte eine einzige Verwaltungsbehörde und eine Fondskoordinationsgruppe ernannt und verfügte nur über drei damit verbundene Programme: ein nationales Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums, ein nationales Fischereiprogramm und ein nationales Programm zur Finanzierung der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung aus dem Regional- und dem Sozialfonds.
72 Den Verwaltungsbehörden zufolge war im Gegensatz dazu in Tschechien und Portugal der Multifonds-Ansatz aufgrund der Kombination verschiedener Fonds mit unterschiedlichen Zielen und Regeln sowie unterschiedlicher Verwaltungsbehörden, die unterschiedliche Vorschriften und Leitlinien anwendeten, schwieriger zu verwalten. (Abbildung 9 sind die unterschiedlichen Vorkehrungen zur Verwaltung des Multifonds-Ansatzes in Schweden, Tschechien und Portugal zu entnehmen). Der Hof fand in den Empfehlungen der Kommission zu den jährlichen Durchführungsberichten der Mitgliedstaaten oder in den Protokollen der jährlichen Sitzungen der Kommission und der Mitgliedstaaten keine Belege für Eingriffe der Kommission, z. B. in Form eines schriftlichen an die Mitgliedstaaten gerichteten Feedbacks zur Verwaltung des Multifonds-Ansatzes oder einer Einforderung von Aktionsplänen, wo dies geboten erschien.
Abbildung 9 – Vorkehrungen für die Verwaltung des Multifonds-Ansatzes

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Eurostat-Karten.
73 Zur Vereinfachung des Multifonds-Ansatzes hat die Kommission für den Programmplanungszeitraum 2021–2027 einige neue Vorkehrungen getroffen:
- Die Mitgliedstaaten müssen eine gemeinsame Aufforderung (für alle betroffenen Fonds) zur Auswahl lokaler Entwicklungsstrategien und lokaler Aktionsgruppen organisieren und einen gemeinsamen Ausschuss zur Begleitung der Durchführung dieser Strategien einrichten38.
- Wählt ein Mitgliedstaat einen federführenden Fonds aus, unterliegt die gesamte lokale Entwicklungsstrategie (d. h. die Verwaltung und die Kontrolle aller Projekte) den Regelungen dieses Fonds, während die Durchführung und Begleitung einzelner Projekte sowie diesbezügliche Zahlungen den Regelungen jenes Fonds unterliegen, über den das betreffende Projekt finanziert wird39.
Der Hof stellte fest, dass Ende Dezember 2021 noch keine gemeinsamen Aufforderungen möglich waren. Die Kommission teilte dem Hof mit, dass dies auf die Verlängerung des Übergangszeitraums für die neue Gemeinsame Agrarpolitik (einschließlich des EU-Fonds für die Entwicklung des ländlichen Raums) bis 2022 zurückzuführen sei, was dazu geführt habe, dass die Regelungen aus dem Zeitraum 2014–2020 weiterhin anwendbar seien.
74 In Schweden erachteten die Behörden die Verwaltung des Multifonds-Ansatzes trotz der vorgenommenen Vereinfachungen als ineffizient und kostenintensiv, insbesondere deshalb, weil im Zeitraum 2014–2020 der Fischerei-, der Regional- und der Sozialfonds gemeinsam nur 20 % der Fördermittel für von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung ausmachten. Die schwedischen Behörden ließen eine Studie zur Bewertung der Finanzierung aller Initiativen im Bereich der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung aus dem Landwirtschaftsfonds erstellen40, aus der hervorging, dass im Zeitraum 2014–2020 lokale Aktionsgruppen ähnliche Projekte im Rahmen anderer Fonds (z. B. in den Bereichen Tourismus und Integration) unterstützt hatten, und dass über 90 % aller im Rahmen der drei anderen EU-Fonds unterstützten Projekte aus Mitteln für die Entwicklung des ländlichen Raums hätten finanziert werden können.
75 Aus diesem Grund wird Schweden den Multifonds-Ansatz wahrscheinlich nicht weiter nutzen. Von den anderen befragten Behörden der Mitgliedstaaten erhielt der Hof gemischte Reaktionen, wobei die meisten einer Nutzung des Multifonds-Ansatzes in der laufenden und der bevorstehenden Programmplanungsperiode ablehnend gegenüberstehen.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
76 Der Hof untersuchte, ob der LEADER-Ansatz der EU insbesondere im Vergleich zu herkömmlichen (Top-down-)Ausgabenprogrammen einen Nutzen erbrachte, der die mit ihm verbundenen zusätzlichen Kosten und Risiken rechtfertigte.
77 Mehr als ein Jahrzehnt nach dem LEADER-Sonderbericht stellte der Hof fest, dass es in einigen Bereichen zu Verbesserungen gekommen ist und durch den LEADER-Ansatz Strukturen geschaffen werden, die das lokale Engagement fördern. Jedoch bringt der LEADER-Ansatz höhere Verwaltungs- und Betriebskosten und langsame Genehmigungsverfahren mit sich und führte nicht zu Projekten mit einem belegbaren Zusatznutzen. Insgesamt stellt der Hof fest, dass es wenige Belege dafür gibt, dass der Nutzen des LEADER-Ansatzes gegenüber dessen Kosten und Risiken überwiegt.
78 LEADER verursacht hohe Verwaltungs- und Betriebskosten, da es sich um einen partizipativen Ansatz handelt. Gemäß der einschlägigen EU-Verordnung sind diese Kosten auf 25 % begrenzt. Im Programmplanungszeitraum 2014–2020 planten die Mitgliedstaaten Verwaltungs- und Betriebskosten in Höhe von 17 %. Die Erleichterung der Umsetzung der lokalen Entwicklungsstrategie und die Unterstützung potenzieller Begünstigter bei der Projektentwicklung sind in diesen Kosten enthalten. Laut der Kommission beliefen sich diese Kosten Ende 2020 auf 1,04 Milliarden Euro (24 % der Gesamtausgaben zu diesem Zeitpunkt, was innerhalb der von der Verordnung vorgegebenen Grenzen liegt). Der Anteil solcher Kosten nimmt im Vergleich zu den Projektausgaben während des Programmplanungszyklus tendenziell ab (Ziffern 25–30).
79 Der Hof stellte fest, dass die lokalen Aktionsgruppen bei der Entwicklung ihrer lokalen Entwicklungsstrategien das lokale Engagement erfolgreich förderten, was gegenüber der Situation, die der Hof vor mehr als einem Jahrzehnt vorfand, eine Verbesserung darstellt. Die meisten von der Prüfung des Hofes erfassten Mitgliedstaaten wendeten geeignete Verfahren für die Auswahl und Genehmigung lokaler Aktionsgruppen auf der Grundlage dieser Strategien an, einige legten jedoch bei der Auswahl lokaler Entwicklungsstrategien weniger strikte Qualitätsstandards an. Der Hof stellte fest, dass ein Mitgliedstaat im Rahmen seines Auswahlverfahrens gar keine Qualitätskriterien anwendete. Die Anwendung solcher Kriterien hätte eine Fokussierung auf die besten lokalen Entwicklungsstrategien ermöglicht (Ziffern 31–37).
80 Der Hof stellte fest, dass das Verfahren zur Projektbeantragung und ‑genehmigung kompliziert war und für Projektträger im Vergleich zu herkömmlichen Ausgabenprogrammen zusätzliche administrative Auflagen mit sich brachte. Dies trug dazu bei, dass die Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Prüfung nur relativ wenige Projekte abgeschlossen und Zahlungen für sie geleistet hatten (39 %). Der Hof stellte außerdem fest, dass die Auswahlkriterien für LEADER-Projekte in den meisten Fällen sehr allgemein formuliert waren, was es den lokalen Aktionsgruppen ermöglichte, viele unterschiedliche Projekte auszuwählen (Ziffern 38–41).
81 Das Projektauswahlverfahren war formell nicht mehr von Behörden dominiert (wie der Hof 2010 feststellt hatte), und lokale Aktionsgruppen konnten das lokale Engagement erfolgreich fördern. 2021 stellte der Hof jedoch fest, dass die meisten lokalen Aktionsgruppen kein ausgewogenes Verhältnis von Männern und Frauen aufwiesen und junge Menschen unterrepräsentiert waren. Dadurch entsteht das Risiko, dass die Ansichten und Interessen von Frauen und jungen Menschen von den Entscheidungsgremien bei der Entscheidungsfindung nicht berücksichtigt werden (Ziffern 42–44).
82 Während einige seiner Empfehlungen aus dem Jahr 2010 umgesetzt worden waren, stellte der Hof fest, dass der Begleitungs- und Bewertungsrahmen der Kommission noch immer keine Belege für den Zusatznutzen des LEADER-Ansatzes im Vergleich zu herkömmlichen Förderungen liefert. Experten sind der Ansicht, dass einige dieser zusätzlichen Nutzeffekte – namentlich im Hinblick auf Sozialkapital und lokale Governance – schwer nachzuweisen sind. In seiner Stellungnahme aus dem Jahr 2018 zu den Vorschlägen der Kommission für die neue Gemeinsame Agrarpolitik betonte der Hof, dass die Kommission bei der Überarbeitung bestehender Rechtsvorschriften den Grundsatz der vorherigen Evaluierung beachten sollte. Die Kommission hat mit der Bewertung des Nutzens von LEADER begonnen (Ziffern 47–53 und 61–63).
83 Die vom Hof vorgenommene Analyse von LEADER-Projekten zeigte, dass sich diese an den in den lokalen Entwicklungsstrategien festgelegten, breit gefassten allgemeinen Zielen orientierten (siehe Ziffer 80). Jedoch stieß der Hof auf Projekte, die in spezifischer Weise Gegenstand von Maßnahmen zur Entwicklung des ländlichen Raums außerhalb von LEADER sowie anderer EU-Ausgabenprogramme sind. Einige Mitgliedstaaten und lokale Aktionsgruppen nutzten LEADER zur Finanzierung von Projekten, die typische gesetzliche Aufgaben von Behörden auf nationaler, regionaler bzw. Gemeindeebene darstellen (Ziffern 54–60).
84 Der Multifonds-Ansatz wurde im Programmplanungszeitraum 2014–2020 eingeführt, um die Unterstützung für die lokale Entwicklung besser zu koordinieren und die Verbindungen zwischen ländlichen, städtischen und Fischereiwirtschaftsgebieten zu stärken. Insgesamt stellte der Hof fest, dass der Multifonds-Ansatz in seiner gegenwärtigen Form die Komplexität der Förderung lokaler Entwicklungsprojekte steigert (Ziffern 64–75).
Empfehlung 1 – Kosten und Nutzen von LEADER umfassend bewerten
Die Kommission sollte sowohl die Kosten als auch den Nutzen umfassend bewerten. Diese Bewertung des LEADER-Ansatzes sollte sich auf Folgendes erstrecken (Buchstaben a–e):
- die Anwendung eines Auswahlverfahrens für lokale Aktionsgruppen, bei dem die Mittel qualitativ hochwertigen lokalen Entwicklungsstrategien zugewiesen werden;
- Maßnahmen zur Senkung der Kosten und administrativen Komplexität (z. B. zusätzlicher Verwaltungsaufwand für Projektträger, lange Auswahlverfahren);
- das Ausmaß, in dem u. a. Altersgruppen, Geschlechter, und andere Zielgruppen in den Entscheidungsgremien angemessen vertreten sind;
- das Ausmaß, in dem durch LEADER finanzierte Projekte im Vergleich zu nicht durch LEADER finanzierten Projekten einen zusätzlichen Nutzen bringen;
- das Ausmaß, in dem LEADER-Mittel zur Finanzierung gesetzlicher Aufgaben von Stellen auf EU-, nationaler, regionaler oder Gemeindeebene verwendet werden.
Zieldatum für die Umsetzung: 2023
Empfehlung 2 – Den Ansatz der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung bewerten
Bei der Bewertung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung sollte die Kommission soweit möglich die in den Buchstaben a–e von Empfehlung 1 genannten Elemente abdecken.
Zieldatum für die Umsetzung: 2025 (für die Ex-Post-Bewertungen für den Zeitraum 2014–2020)
Dieser Bericht wurde von Kammer I unter Vorsitz von Frau Joëlle ELVINGER, Mitglied des Rechnungshofs, am 4. Mai 2022 in Luxemburg angenommen.
Für den Rechnungshof

Klaus-Heiner Lehne
Präsident
Anhänge
Anhang I – Spezifische Indikatoren im Zusammenhang mit LEADER und der von der örtlichen Bevölkerung betriebenen lokalen Entwicklung
| Tabelle 6 – ELER | EMFF | EFRE | ESF |
|---|---|---|---|
| Keine CLLD-spezifischen Indikatoren | Keine CLLD-spezifischen Indikatoren | ||
| O.18: Von einer lokalen Aktionsgruppe abgedeckte Personen O.19: Zahl der ausgewählten lokalen Aktionsgruppen O.20: Zahl der unterstützten LEADER-Projekte O.21: Zahl der unterstützten Kooperationsprojekte O.22: Art und Anzahl der Projektträger O.23: Individuelle Kennnummer der an einem Kooperationsprojekt beteiligten lokalen Aktionsgruppen |
|
||
| T21/R22: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, für die lokale Entwicklungsstrategien gelten T22/R23: Prozentsatz der Bevölkerung im ländlichen Raum, die von verbesserten Dienstleistungen/Infrastrukturen profitiert T23/R24: In unterstützten Projekten geschaffene Arbeitsplätze (LEADER) |
|
Quellen: ELER: Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission; EMFF: Anhang der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 1014/2014 der Kommission.
Anhang II – Für diesen Prüfungsbericht durchgeführte Weiterverfolgung des Sonderberichts 05/2010 durch den Europäischen Rechnungshof
| Empfehlungen | Antworten der Kommission | Weiterverfolgung des Hofes | ||
|---|---|---|---|---|
| Empfehlung 1 | ||||
| Angesichts der anhaltenden Mängel sollte die Kommission dafür sorgen, dass in den Rechtsvorschriften die im spezifischen Fall von Leader verlangten Standards hinreichend klar festgelegt werden. Durch einige einfache Anforderungen auf EU-Ebene erübrigen sich möglicherweise abweichende Durchführungsbestimmungen auf Programmebene; außerdem wird es möglich, Verfahren zu vereinfachen, die Kohärenz zu verbessern und klare Kontrollstandards in folgenden Bereichen festzulegen: | ||||
|
|
|
||
|
|
|
||
|
|
|
||
| Zusätzlich sollten die Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass mit Blick auf die in diesem Bericht aufgezeigten Mängel wirksame Verfahren eingerichtet werden und das ordnungsgemäße Funktionieren dieser Verfahren überwacht wird. |
|
|||
| Empfehlung 2 | ||||
| Aufgrund der Haushaltsordnung sind alle Handlungen untersagt, die zu einem Interessenkonflikt führen können. Im Hinblick darauf sollten Kommission und Mitgliedstaaten dafür sorgen, dass wirksame Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, und überprüfen, ob diese ordnungsgemäß funktionieren. Die Mitglieder der Projektbewertungs- oder Entscheidungsgremien der LAG, die etwaige persönliche, politische, berufliche oder geschäftliche Interessen an einem Projektvorschlag haben, sollten dieses Interesse schriftlich offenlegen. Sie sollten bei allen Beratungen, Bewertungen oder Entscheidungen zu dem Projekt abwesend sein, und gemäß der Haushaltsordnung sollte die Verwaltungsbehörde befasst werden. | Die Kommission stimmt mit dem Hof darin überein, dass es im Hinblick auf den Entscheidungsfindungsprozess im Falle von Interessenkonflikten klare Regeln geben muss, die strikt einzuhalten sind. Art. 61.1(b) der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005 sieht vor, dass auf der Entscheidungsebene die Wirtschafts- und Sozialpartner sowie weitere Vertreter der Zivilgesellschaft mindestens 50 % der Partnerschaft ausmachen müssen. Die Kommission wird mit den "Leitlinien für die Anwendung des Leader-Konzepts" auch vorbildliche Praktiken fördern und die Mitgliedstaaten auffordern, effiziente Sicherungsmaßnahmen zu gewährleisten und zu überprüfen. |
|
||
| Empfehlung 3 | ||||
| Die Kommission sollte zusammen mit den Mitgliedstaaten überprüfen, ob die bestehenden Maßnahmen die Fähigkeit der LAG, innovative, sektorübergreifende, lokale Strategien zur Verwirklichung der Ziele der Schwerpunkte 1 bis 3 der Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums zu konzipieren und umzusetzen, einschränken. Die Mitgliedstaaten sollten ihre Regeln ggf. ändern, um es den LAG zu ermöglichen, lokale Lösungen zu entwickeln, die nicht den Maßnahmen des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum entsprechen. | Änderungen an den Programmen für die Entwicklung des ländlichen Raums (RDP) im Hinblick auf eine verbesserte Umsetzung der lokalen Strategie sind jederzeit möglich. Ferner können die "Leitlinien für die Anwendung des Leader-Konzepts" im Sinne einer verbesserten Orientierungshilfe für die Mitgliedstaaten im Bereich der Förderung von (innovativen) Projekten außerhalb des Maßnahmenkatalogs überarbeitet werden. Seit Ende 2009 ändern mehrere Mitgliedstaaten mit Blick auf eine verbesserte Wirksamkeit der Umsetzung der Leader-Methode ihre Programme in der Hinsicht, dass sie mehr Flexibilität insbesondere durch die Einführung von integrierten oder spezifischen Maßnahmen zulassen. Dies ist zu einem beträchtlichen Teil eine Konsequenz aus den Diskussionen, die die Kommission im Rahmen des Leader-Unterausschusses des Europäischen Netzwerks für ländliche Entwicklung angeregt hat. |
|
||
| Empfehlung 4 | ||||
| Die Kommission sollte dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten die Strategien der LAG für den Programmplanungszeitraum 2007–2013 überprüfen und die LAG dazu anhalten, messbare, für ihr lokales Gebiet spezifische Ziele festzulegen, die im Rahmen des Leader-Programms in der Restzeit des Programmplanungszeitraums verwirklicht werden können. Anschließend sollten die Mitgliedstaaten die LAG dazu verpflichten, über die Verwirklichung der lokalen Strategieziele, über die Erzielung zusätzlicher Nutzeffekte im Wege des Leader-Konzepts sowie über die Wirtschaftlichkeit der Förderausgaben und Geschäftsführungskosten Rechenschaft abzulegen. | Die Berichte über die Halbzeitbewertung, die Ende 2010 vorgelegt werden müssen, werden Empfehlungen für Änderungen an den Programmen für die Entwicklung des ländlichen Raums enthalten, um die Programminhalte auf die Ziele abstimmen zu können. Die Kommission wird diese Gelegenheit ergreifen, um mit den Mitgliedstaaten die Umsetzung des Schwerpunkts 4 zu erörtern, insbesondere die Möglichkeit einer Qualitätsverbesserung der lokalen Entwicklungsstrategien und ihrer Umsetzung unter anderem durch eine verbesserte Begleitung und Bewertung auf LAG-Ebene. Die Sammlung und Verbreitung beispielhafter Praktiken für die Begleitung auf LAG-Ebene durch das Europäische Netz für die ländliche Entwicklung (ENRD) und für die Evaluierung im Zusammenhang mit dem Europäischen Evaluierungsnetz für die Entwicklung des ländlichen Raums werden dabei besonders in Erwägung gezogen. |
|
||
| Die Mitgliedstaaten sollten ferner überlegen, ob diese verstärkte Verpflichtung zur Rechenschaftslegung über die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung eine Straffung der bestehenden Verwaltungs-, Überwachungs- und Kontrollsysteme ermöglichen könnte, sodass in geringerem Maß die Notwendigkeit bestünde, die Einhaltung der Förderfähigkeitsbedingungen für Maßnahmen zu prüfen. |
|
|||
| Empfehlung 5 | ||||
| Angesichts ihrer Verantwortung für die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung im Rahmen des EU-Haushalts sollte die Kommission künftige Programme hinreichend ausführlich auf die spezifischen Bestandteile prüfen, die für den Mehrwert, die Wirksamkeit und die Wirtschaftlichkeit von Leader maßgeblich sind. | Im Zusammenhang mit der Programmgenehmigung für den laufenden Programmplanungszeitraum hat die Kommission im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung die in Anhang 2 der Verordnung (EG) Nr. 1974/2006 vorgesehenen Schlüsselelemente untersucht. Allerdings müssen nach der Programmgenehmigung unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips weitere zusätzliche Leader-Verwaltungselemente von den Verwaltungsbehörden definiert werden. |
|
||
| Die Mitgliedstaaten sollten künftig dafür sorgen, dass die LAG alle im Zusammenhang mit dem Auswahlverfahren aufgezeigten Mängel beseitigen, damit sie über Strategien und Umsetzungspläne nach dem höchstmöglichen Standard verfügen. |
|
|||
| Empfehlung 6 | ||||
| Die Kommission sollte dringend Maßnahmen ergreifen, um in der Lage zu sein, Rechenschaft über den Mehrwert und die Wirtschaftlichkeit der Haushaltsführung im Zusammenhang mit Leader abzulegen. Die Begleitung sollte auf Indikatoren für den mit dem Leader-Konzept verbundenen Mehrwert sowie für Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit und nicht für Umsetzung ausgerichtet werden. Die Daten sollten zumindest stichprobenweise an der Quelle überprüft werden. Angesichts von Umfang und Art des Leader-Programms und der bisher aufgetretenen Schwierigkeiten bei der Beschaffung relevanter, vergleichbarer und zuverlässiger Angaben sollte die Kommission effizientere und wirksamere Ansätze ins Auge fassen, wie etwa die eingehende Überwachung statistisch gültiger Stichproben von LAG anhand von Indikatoren, Vor-Ort-Kontrollen und strukturierten Fallstudien, wozu auch eine ordnungsgemäße Datenüberprüfung durch einen unabhängigen Evaluator gehört. | Es besteht ein ständiger Dialog zwischen den Mitgliedstaaten, um die Umsetzung des Leader-Konzepts durch den Leader-Unterausschuss des Europäischen Netzwerks für die ländliche Entwicklung (ENRD) zu verbessern. Die Kommission befindet sich auch hinsichtlich der Verbesserung des Gemeinsamen Begleitungs- und Bewertungsrahmens sowie der Indikatoren zur Überwachung von Leader im Dialog mit den Mitgliedstaaten. Die Kommission hat kürzlich die Schlussfassung eines Arbeitspapiers zur Bewertung der Auswirkungen des Leader-Konzepts auf die ländlichen Gebiete fertiggestellt. Die Unterschiede zwischen den Strategien lassen kein Sammeln derselben Informationen in allen LAG zu, da die Umsetzung einer lokalen Strategie prozessorientiert ist. Individuelle Bewertungen sollen im Sinne einer Einhaltung des Verhältnisses zwischen den Kosten und der Effizienz des Evaluierungsprozesses an sich begrenzt bleiben. |
|
||
| Die Kommission sollte die Mitgliedstaaten koordinieren, um sicherzustellen, dass die Überwachungs- und Kontrollsysteme Gewissheit über die Fairness und Transparenz von Verfahren bieten, vergleichbare Daten zu den Kosten liefern und die Überwachung der Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit ergänzen. |
|
Anhang III – Liste der geprüften Projekte (Stand der Ausgaben: Mai 2021)
| Projektbeschreibung | Art des Projektträgers | Öffentliche Ausgaben (in Euro) | EU-Beitrag (in Euro) | ESI-Fonds |
|---|---|---|---|---|
| Tschechien | ||||
| Sanierung des Zentrums einer Gemeinde (Gehweg und Bushaltebucht) | Öffentliche Stelle | 98 069,98 | 93 166,48 | EFRE |
| Behindertengerechte Grundschule | Öffentliche Stelle | 77 822,80 | 73 931,73 | EFRE |
| Kauf von Landmaschinen (Multifunktionaler Radlader) | KMU | 29 420,99 | 11 297,66 | ELER |
| Kauf von Ausrüstung zur Wiederinstandsetzung historischer Eisenbahnwaggons | KMU | 6 268,63 | 1 805,35 | ELER |
| Tagescamps für Kinder | LAG | 100 389,34 | 85 330,94 | ESF |
| Landwirtschaftliche Investitionen in Ställe und Maschinen für die Tierproduktion | Privater landwirtschaftlicher Betrieb | 194 224,11 | 74 582,03 | ELER |
| Kauf von Landmaschinen (Traktor) | KMU | 77 867,57 | 22 269,18 | ELER |
| Kauf von Landmaschinen (Radlader und Förderer) | KMU | 62 725,56 | 24 086,62 | ELER |
| Kauf einer Wärmepumpe für ein Touristen-Gästehaus | KMU | 7 061,04 | 2 033,58 | ELER |
| Kauf von Ausrüstung für eine Kunstschmiede | KMU | 3 510,91 | 1 011,14 | ELER |
| Deutschland (Sachsen) | ||||
| Umbau zu einer integrativen Kindertagesstätte | Öffentliche Stelle | 375 000,00 | 300 000,00 | ELER |
| Abbruch eines baufälligen Einfamilienhauses | Privatperson | 9 196,32 | 7 357,06 | ELER |
| Renovierung eines ehemaligen Pfarrhauses für private Zwecke | Privatperson | 160 000,00 | 128 000,00 | ELER |
| Errichtung eines Angelstegs für Menschen mit Behinderung | NRO | 70 753,80 | 47 688,23 | EMFF |
| Integrativer Abenteuerspielplatz mit geologischem Hintergrund | NRO | 41 003,44 | 32 802,75 | ELER |
| Wiederaufbau und Sanierung einer ehemaligen Poliklinik für die Wiederansiedlung neuer Ärzte | KMU | 200 000,00 | 160 000,00 | ELER |
| Behindertengerechte Sanierung eines Badezimmers in einer Privatwohnung | Privatperson | 5 463,87 | 4 371,10 | ELER |
| Abbruch eines ehemaligen Lehrlingsheims | Landwirtschaftliche Genossenschaft | 15 000,00 | 12 000,00 | ELER |
| Renovierung von Straßenlampen | Öffentliche Stelle | 2 981,16 | 2 384,93 | ELER |
| Umbau von Frachtcontainern zu Ferienwohnungen | KMU | 29 152,85 | 23 322,28 | ELER |
| Estland | ||||
| Modernisierung eines Schwimmbads – Bau eines Gesundheits- und Kinderbeckens | Öffentliche Stelle | 80 000,00 | 64 000,00 | ELER |
| Einrichtung einer Wollverarbeitungswerkstatt – Kauf einer Krempel und Adaptierung von Produktionsanlagen | KMU | 25 706,24 | 23 135,61 | ELER |
| Kauf eines Transportanhängers für Rinder und Schafe (Nutzung durch drei landwirtschaftliche Betriebe) | KMU | 4 043,60 | 3 234,88 | ELER |
| Audiovisuelle Projektionslösungen für ein geschichtliches Bildungszentrum | NRO | 10 000,00 | 8 000,00 | ELER |
| Umbau eines ehemaligen Bahnhofsgebäudes in eine Wartehalle des öffentlichen Verkehrs und ein Museum | NRO | 72 911,64 | 58 329,28 | ELER |
| Kauf einer Steinschneidemaschine zur Bearbeitung von Feldsteinen | KMU | 65 040,00 | 52 032,00 | ELER |
| Naturtourismus-Schulung für Schüler | Öffentliche Stelle | 3 233,16 | 2 586,52 | ELER |
| Errichtung eines Skateparks | NRO | 17 836,94 | 14 269,54 | ELER |
| Kauf von Ausrüstung für die Arbeit einer Kirchengemeinde | NRO | 4 943,13 | 3 954,47 | ELER |
| Anlegen eines Kunstrasens für einen Sportplatz | NRO | 139 999,80 | 111 999,84 | ELER |
| Irland | ||||
| Entwicklung und Bau eines Gebäudes | NRO | 500 000,00 | 314 000,00 | ELER |
| Gemeinde-Skatepark | NRO | 127 671,00 | 80 177,39 | ELER |
| Erweiterung einer Reitschule | KMU | 56 062,97 | 35 207,55 | ELER |
| Marketingkampagne eines Privatunternehmens | KMU | 19 374,37 | 12 167,10 | ELER |
| Sozioökonomische Planung einer Gemeinde | LAG | 26 442,90 | 16 606,14 | ELER |
| Kauf von Computerausrüstung in einem ländlichen Tourismusbetrieb | Privat | 5 008,25 | 3 145,18 | ELER |
| Kapazitätsaufbau zu einem Besucherzentrum | NRO | 52 170,10 | 32 762,82 | ELER |
| Verbesserungsarbeiten an einer kulturellen Stätte | NRO | 200 000,00 | 125 600,00 | ELER |
| Verbesserung von Geschäftsräumlichkeiten | KMU | 117 567,47 | 73 832,37 | ELER |
| Biodiversitäts- und Ökologiestudie | NRO | 8 966,70 | 5 631,09 | ELER |
| Griechenland | ||||
| Musikfestival | NRO | 31 520,00 | 28 112,69 | ELER |
| Verbesserung der Straßeninfrastruktur | Öffentliche Einrichtung | 580 000,00 | 517 302,00 | ELER |
| Projekt einer Kultur-NRO | Kulturverein | 13 633,42 | 12 159,65 | ELER |
| Verbesserungsmaßnahmen an einer Schule für besondere Bedürfnisse | Verein der Eltern und Freunde von Kindern mit besonderen Bedürfnissen | 182 329,93 | 162 620,06 | ELER |
| Projekt einer Kultur-NRO | Kulturverein | 10 515,20 | 9 378,50 | ELER |
| Beherbergungsprojekt für Touristen | Privat | 265 803,55 | 239 223,20 | ELER |
| Errichtung einer neuen Produktionsstraße | Privat | 125 040,00 | 112 048,34 | ELER |
| Modernisierung eines Unternehmens | Privat | 11 113,00 | 9 958,36 | ELER |
| Finanzierung eines neuen Geschäftsbereichs | Privat | 57 220,60 | 51 275,38 | ELER |
| Finanzierung einer Produktionseinheit für Milcherzeugnisse | Privat | 61 017,48 | 54 677,76 | ELER |
| Österreich | ||||
| Erprobung lokaler Pop-up-Shop-Konzepte | Tourismusverband | 102 398,29 | 32 767,46 | ELER |
| Entwicklung der Produktion und Verarbeitung hochwertiger Kräuter und Gewürze | Genossenschaft | 341 956,33 | 109 426,02 | ELER |
| Unterstützung für die Einrichtung der ersten Montessori-Schule in der Region | Genossenschaft | 57 126,95 | 27 177,60 | ELER |
| Entwicklung eines Konzepts für ein "intelligentes Dorf" durch "Design Thinking". | Öffentliche Stelle | 7 560,00 | 3 628,80 | ELER |
| Erkundung neuer Wege zu innovativen Projekten (Kooperationsprojekt dreier österreichischer LAG einschließlich der beiden geprüften LAG) |
NRO | 376 305,71 | 240 000,00 | ELER |
| Kleines Observatorium für Amateur-Astronomen, Schulen und die interessierte Öffentlichkeit | NRO | 55 929,40 | 26 145,60 | ELER |
| Gründungsunterstützung für nachhaltiges Unternehmertum in unterschiedlichen Wirtschaftssektoren | NRO | 85 608,00 | 41 091,84 | ELER |
| Herstellung und Vermarktung von Anzündholz | Genossenschaft | 15 000,00 | 4 800,00 | ELER |
| Traditionelle Bewirtschaftung steiler Bergweiden | NRO | 23 850,00 | 11 448,00 | ELER |
| Portugal (Festland) | ||||
| Umbau alter Windmühlen zu Touristenunterkünften | Einzelunternehmen (Empresário em Nome Individual) |
181 561,09 | 72 624,47 | ELER |
| Kauf gewerblicher Küchengeräte für die Herstellung von Konfitüren, Chutneys, Saucen usw. | KMU | 47 378,22 | 12 507,59 | ELER |
| Bewahrung und Restaurierung von Windmühlen und deren Umgebung (Freiluftmuseum) | Öffentliche Stelle | 149 000,00 | 89 400,00 | ELER |
| Renovierung des Holzofens einer Gemeinde | Öffentliche Stelle | 8 285,90 | 3 597,44 | ELER |
| Kauf von Anlagen zur Käseherstellung für eine Molkerei | KMU | 171 066,39 | 68 551,57 | ELER |
| Unterstützung für die Schaffung von Arbeitsplätzen in einer Craft-Bier-Brauerei | KMU | 10 458,24 | 5 229,12 | ESF |
| Kauf von Ausrüstung für eine Craft-Bier-Brauerei | KMU | 31 571,56 | 12 628,63 | EFRE |
| Unterstützung für die Schaffung von Arbeitsplätzen bei einem Pannenhilfe-Unternehmen | KMU | 6 052,62 | 5 144,73 | ESF |
| Modernisierung und Kauf von Geräten für ein Fitnessstudio | KMU | 99 195,60 | 39 678,23 | EFRE |
| Modernisierung einer lokalen Wohneinheit | KMU | 31 013,41 | 12 405,36 | EFRE |
| Rumänien | ||||
| Errichtung eines Radwegs in einem Dorf | Behörde | 81 624,00 | 72 906,56 | ELER |
| Kauf landwirtschaftlicher Maschinen | KMU | 160 226,27 | 143 114,11 | ELER |
| Kauf von Ausrüstung für eine Semisubsistenz-Imkerei | KMU | 13 975,50 | 12 482,92 | ELER |
| Kauf von Ausrüstung für einen Tierpräparator | KMU | 1 047,31 | 935,46 | ELER |
| Kauf landwirtschaftlicher Maschinen (Junglandwirt) | KMU | 84 574,13 | 75 541,62 | ELER |
| Kauf landwirtschaftlicher Maschinen (Junglandwirt) | KMU | 27 951,00 | 24 965,83 | ELER |
| Einrichtung eines Schönheitssalons in einem Dorf | KMU | 23 292,50 | 20 804,86 | ELER |
| Integriertes Zentrum für soziale Dienste in einem Dorf | NRO | 5 820,00 | 5 198,42 | ELER |
| Anlegen eines Kunstrasens | Behörde | 3 979,20 | 3 554,22 | ELER |
| Einrichtung einer Physiotherapie-Praxis in einer Kleinstadt | KMU | 23 292,50 | 20 804,86 | ELER |
| Slowakei | ||||
| Umbau und Renovierung eines Gebäudes für die Herstellung von Komposit-Netzen | KMU | 177 424,76 | 97 583,62 | EFRE |
| Anlagen für die Herstellung halbfertiger Kunstkränze | KMU | 103 524,20 | 56 938,31 | EFRE |
| Kauf eines achtsitzigen Fahrzeugs für den Nahverkehr (z. B. für Kinder und älteren Personen) | Öffentliche Stelle (Gemeinde) | 34 210,53 | 32 500,00 | EFRE |
| Öffentliche Kanalisation | Öffentliche Stelle | 25 000,00 | 18 750,00 | ELER |
| Gestaltung und Errichtung eines Lehrpfads | Öffentliche Stelle | 24 936,70 | 18 702,53 | ELER |
| Sanierung von Gemeindestraßen | Öffentliche Stelle | 22 233,18 | 16 674,89 | ELER |
| Schweden | ||||
| Innovative öffentliche Verkehrslösungen für Touristen und die örtliche Bevölkerung (Machbarkeitsstudie) | NRO | 29 930,67 | 14 965,34 | ELER |
| Hunde-Tagesbetreuung – berufliche Wiedereingliederung von Menschen mit Behinderung | KMU | 108 894,76 | 54 447,38 | ESF |
| Schwimmschule für die örtliche Bevölkerung in einer dünn besiedelten Region | KMU | 15 585,82 | 7 792,91 | EFRE |
| LAG-eigenes Projekt zur Unterstützung lokaler Start-ups | LAG | 26 852,69 | 13 426,34 | ELER |
| IT-basierte faire Direktvermarktung lokaler Lebensmittel | NRO | 54 600,31 | 27 300,15 | ELER |
| Sportprojekt zur Förderung der Integration von lokalen Einwohnern und Migranten | NRO | 106 785,60 | 53 392,80 | ELER |
| Neue Möglichkeiten der Erhaltung der gewerblichen Fischerei vor Ort (Machbarkeitsstudie) | NRO | 6 736,32 | 3 368,16 | EMFF |
| LAG-eigenes Projekt zur Unterstützung junger Menschen bei der Gestaltung und Umsetzung eigener Projekte (ELER) | LAG | 153 930,76 | 76 965,38 | ELER |
| LAG-eigenes Projekt zur Unterstützung junger Menschen bei der Gestaltung und Umsetzung eigener Projekte (EFRE) | LAG | 38 519,59 | 19 259,79 | EFRE |
| Theaterprojekt und Catering mit lokalen Lebensmittelspezialitäten | NRO | 66 640,00 | 33 320,00 | ELER |
Akronyme und Abkürzungen
CLLD: Community-led local development – von der örtlichen Bevölkerung betriebene lokale Entwicklung
EAGFL: Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
EFF: Europäischer Fischereifonds
EFRE: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung
ELER: Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums
EMFF: Europäischer Meeres- und Fischereifonds
ENRD: European Network for Rural Development – Europäisches Netz für die Entwicklung des ländlichen Raums
ESF: Europäischer Sozialfonds
ESI-Fonds: europäische Struktur- und Investitionsfonds
EU: Europäische Union
FARNET: Netzwerk für Fischereiwirtschaftsgebiete
FLAG: lokale Fischereiaktionsgruppe
GAP: Gemeinsame Agrarpolitik
GD AGRI: Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung
GD EMPL: Generaldirektion Beschäftigung, Soziales und Integration
GD MARE: Generaldirektion Maritime Angelegenheiten und Fischerei
GD REGIO: Generaldirektion Regionalpolitik und Stadtentwicklung
LAG: lokale Aktionsgruppe
LEADER: Liaison entre actions de développement de l'économie rurale – Verbindung zwischen Maßnahmen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft
OP: operationelles Programm
RDP: Rural Development Programme – Entwicklungsprogramm für den ländlichen Raum
Glossar
Ein Mitnahmeeffekt entsteht dann, wenn Mittel zur Unterstützung eines Begünstigten bereitgestellt werden, der auch ohne diese Hilfe dieselbe Entscheidung getroffen hätte. In solchen Fällen kann die erzielte Wirkung nicht der entsprechenden politischen Maßnahme zugeschrieben werden, und die an den Begünstigten ausgezahlte Beihilfe hatte keine Auswirkungen. Somit ist der Anteil der Ausgaben, der zu Mitnahmeeffekten führt, definitionsgemäß unwirksam, da er nicht zur Erreichung der Ziele beiträgt. Im Rahmen dieser Prüfung bezeichnet der Begriff Mitnahmeeffekt den Sachverhalt, dass ein gefördertes Projekt ganz oder teilweise auch ohne die Finanzhilfe durchgeführt worden wäre.
Europäische Struktur- und Investitionsfonds (ESI-Fonds): fünf wichtige EU-Fonds mit dem gemeinsamen Ziel der Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in allen EU-Mitgliedstaaten entsprechend den Zielen der Strategie Europa 2020. Es handelt sich um den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), den Europäischen Sozialfonds (ESF), den Kohäsionsfonds (KF), den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) und den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF).
Governance und Sozialkapital sind jeweils undeutliche und umstrittene Begriffe. In diesem Bericht bezieht sich der Hof auf die Definitionen der Kommission (siehe Ziffer 61).
Lokale Entwicklungsstrategie (CLLD): kohärentes Bündel von Vorhaben zum Erreichen lokaler Ziele und zur Erfüllung lokaler Bedürfnisse, das zur Verwirklichung der Strategie Europa 2020 beiträgt und von einer LAG konzipiert und umgesetzt wird.
Marktversagen: Marktversagen bezieht sich auf die ineffiziente Verteilung von Gütern und Dienstleistungen im freien Markt. Marktversagen kann auf dem Markt aus mehreren Gründen auftreten, etwa aufgrund externer Effekte, sogenannter öffentlicher Güter, unvollständiger Informationen auf dem Markt oder einer Marktbeherrschung (Monopol/Oligopol).
Antworten der Kommission
Prüfungsteam
Die Sonderberichte des Hofes enthalten die Ergebnisse seiner Prüfungen zu Politikbereichen und Programmen der Europäischen Union oder zu Fragen des Finanzmanagements in spezifischen Haushaltsbereichen. Bei der Auswahl und Gestaltung dieser Prüfungsaufgaben ist der Hof darauf bedacht, maximale Wirkung dadurch zu erzielen, dass er die Risiken für die Wirtschaftlichkeit oder Regelkonformität, die Höhe der betreffenden Einnahmen oder Ausgaben, künftige Entwicklungen sowie das politische und öffentliche Interesse abwägt.
Diese Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde von Prüfungskammer I "Nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen" unter Vorsitz von Joëlle Elvinger, Mitglied des Hofes, durchgeführt. Die Prüfung stand ursprünglich unter der Leitung von João Figueiredo(†), Mitglied des Hofes. Herr Figueiredo wurde unterstützt von seiner Kabinettchefin Paula Betencourt und dem Attaché Quirino Mealha.
Die Prüfung wurde von Eva Lindström, Mitglied des Hofes, abgeschlossen. Frau Lindström wurde unterstützt von ihrer Kabinettchefin Katharina Bryan, dem Leitenden Manager Michael Bain, der Leitenden Managerin Florence Fornaroli und der Aufgabenleiterin Joanna Kokot. Zum Prüfungsteam gehörten außerdem Vasileia Kalafati, Anca Florinela Cristescu, Liia Laanes, Marika Meisenzahl (auch Grafikdesign) und Anna Zalega. Daniela Jinaru, Jan Kubat, Michael Pyper und Marek Říha leisteten sprachliche Unterstützung.

Endnoten
1 Website der Kommission zu LEADER.
2 Sonderbericht 05/2010: Umsetzung des Leader-Konzepts zur Entwicklung des ländlichen Raums.
3 Sonderbericht 05/2010: Umsetzung des Leader-Konzepts zur Entwicklung des ländlichen Raums.
4 Workshop-Dokument des Europäischen Netzes für die Entwicklung des ländlichen Raums: LEADER: 30 years and preparing for the future: delivering LEADER’s unique added value.
5 Europäische Kommission: Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen SWD(2021) 166 final, Teil 2/3.
6 D. h. beim Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER), beim Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), beim Europäischen Sozialfonds (ESF) und beim Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).
7 Anhang IV der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 808/2014 der Kommission.
8 Jährlicher Tätigkeitsbericht 2019 der Generaldirektion Landwirtschaft und ländliche Entwicklung.
10 Artikel 86 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2021/1060.
11 Jahresbericht zum Haushaltsjahr 2000.
12 Sonderbericht 05/2010: Umsetzung des Leader-Konzepts zur Entwicklung des ländlichen Raums.
13 Sonderbericht 19/2013: Bericht 2012 über die Weiterverfolgung der Sonderberichte des Europäischen Rechnungshofs.
14 Guidance for Member States and Programme Authorities on CLLD in ESI Funds.
15 Artikel 33 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
16 Guidance for Member States and programme authorities on CLLD in the ESI Funds, Abschnitt 7.3, S. 42–43.
17 Guidance for Member States and programme authorities on CLLD in the ESI Funds, Abschnitt 7.3, S. 42.
18 Guidance for Member States and programme authorities on CLLD in the ESI Funds, S. 24–25.
19 Artikel 32 Absatz 2 Buchstabe b und Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
20 Guidance for Member States and programme authorities on CLLD in the ESI Funds, S. 27.
21 Als junge Menschen werden Menschen im Alter von 18 bis 30 Jahren verstanden, siehe Europarat und Europäische Kommission, Grundlagen der Jugendpolitik, 2019, S. 6.
22 Bericht des Europäischen Rechnungshofs zur Leistung des EU-Haushalts – Stand zum Jahresende 2019.
23 Artikel 54 bis 57 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013.
24 Guidelines, Evaluation of LEADER/CLLD.
25 Europäische Kommission: FARNET-Leitfaden #15: CLLD bewerten. Ein Handbuch für LAG und FLAG, 2018.
26 Artikel 57 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 1303/2013 und Artikel 2 Absatz 4 der Verordnung (EU) 2020/2220.
27 Artikel 87 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1698/2005.
28 Europäische Kommission, Synthesis of Rural Development Programmes (RDPs) ex-post evaluations of period 2007-2013, Luxemburg 2020, S. 222–234.
29 Stellungnahme des Hofes aus dem Jahr 2018 zu den Vorschlägen der Kommission für Verordnungen zur Gemeinsamen Agrarpolitik für die Zeit nach 2020.
30 Evaluation Roadmap: Evaluation of the impact of LEADER on balanced territorial development.
31 Guidelines, Evaluation of LEADER/CLLD.
32 Zentralbewertung des Entwicklungsprogramms für den ländlichen Raum 2014–2020 im Freistaat Sachsen. Endbericht, S. 257.
33 Sonderbericht 25/2015: EU-Infrastrukturförderung im ländlichen Raum.
34 Nardone, G., Sisto, R. u. Lopolito, A., Social Capital in the LEADER Initiative: a methodological approach, Journal of Rural Studies, Band 26, Ausgabe 1, 2010, S. 63–72.
Pisani, E., Franceschetti, G.; Secco, L. und Christoforou, A. (Hg.), "Social Capital and Local Development: From Theory to Empirics", Cham (Schweiz), 2017.
Claridge, T., Current definitions of social capital – Academic definitions in 2019, 2020, einschließlich Link zur Präsentation Social capital – is there an accepted definition in 2020?
Shucksmith, M., Endogenous Development, Social Capital and Social Inclusion: perspectives from leader in the UK, Sociologia Ruralis, 40(2), 2002, S. 208–218.
Thuesen, A. A., Is LEADER elitist or inclusive? Composition of Danish LAG boards in the 2007–2013 rural development and fisheries programmes, Sociologia ruralis, 50(1), 2010, S. 31–45.
35 Verordnung (EU) Nr. 1303/2013, einschließlich Anhang I (Gemeinsamer Strategischer Politikrahmen).
36 Kah, S., Update: Implementing cohesion policy funds through multi-Fund CLLD, 2021 (Daten korrekt mit Stand von Juni 2021).
37 Europäische Kommission, FARNET-Leitfaden #10: Startschuss zur praktischen Umsetzung von CLLD, 2016.
38 Artikel 31 Absatz 3 der Verordnung (EU) 2021/1060.
39 Artikel 31 Absätze 4 bis 6 der Verordnung (EU) 2021/1060.
40 Är det möjligt att finansiera alla insatser inom lokalt ledd utveckling genom jordbruksfonden? Uppföljningsrapport 2019:11 (Ist es möglich, alle CLLD-Initiativen aus dem Landwirtschaftsfonds [ELER] zu finanzieren? Follow-up-Bericht 2019:11).
Kontakt
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
Tel. +352 4398-1
Kontaktformular: eca.europa.eu/de/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (https://europa.eu).
Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2022
| ISBN 978-92-847-8088-4 | ISSN 1977-5644 | doi:10.2865/225593 | QJ-AB-22-012-DE-N | |
| HTML | ISBN 978-92-847-8107-2 | ISSN 1977-5644 | doi:10.2865/843501 | QJ-AB-22-012-DE-Q |
URHEBERRECHTSHINWEIS
© Europäische Union, 2022
Die Weiterverwendung von Dokumenten des Europäischen Rechnungshofs wird durch den Beschluss Nr. 6-2019 des Europäischen Rechnungshofs über die Politik des offenen Datenzugangs und die Weiterverwendung von Dokumenten geregelt.
Sofern nicht anders angegeben (z. B. in gesonderten Urheberrechtshinweisen), werden die Inhalte des Hofes, an denen die EU die Urheberrechte hat, im Rahmen der Lizenz Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) zur Verfügung gestellt. Dies bedeutet, dass die Weiterverwendung mit ordnungsgemäßer Nennung der Quelle und unter Hinweis auf Änderungen im Allgemeinen gestattet ist. Personen, die Inhalte des Hofes weiterverwenden, dürfen die ursprüngliche Bedeutung oder Botschaft nicht verzerrt darstellen. Der Hof haftet nicht für etwaige Folgen der Weiterverwendung.
Eine zusätzliche Genehmigung muss eingeholt werden, falls ein bestimmter Inhalt identifizierbare Privatpersonen zeigt, z. B. Fotos von Hofbediensteten, oder Werke Dritter enthält.
Wird eine solche Genehmigung eingeholt, so hebt diese die oben genannte allgemeine Genehmigung auf und ersetzt sie; auf etwaige Nutzungsbeschränkungen wird ausdrücklich hingewiesen.
Um Inhalte zu verwenden oder wiederzugeben, an denen die EU keine Urheberrechte hat, kann es erforderlich sein, eine Genehmigung direkt bei den Urheberrechtsinhabern einzuholen.
Abbildung 2:
- Bildsymbole

 von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/
von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/ - Bildsymbol
 von pongsakornRed auf der Plattform https://flaticon.com/
von pongsakornRed auf der Plattform https://flaticon.com/
Abbildungen 3 und 4:
- Bildsymbole

 von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/
von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/ - Bildsymbol
 von xnimrodx auf der Plattform https://flaticon.com/
von xnimrodx auf der Plattform https://flaticon.com/ - Bildsymbol
 von Smashicons auf der Plattform https://flaticon.com/
von Smashicons auf der Plattform https://flaticon.com/
Abbildung 5:
- Bildsymbole

 von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/
von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/ - Bildsymbol
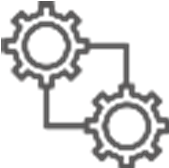 von xnimrodx https://flaticon.com/
von xnimrodx https://flaticon.com/
Kasten 2: Bildsymbol ![]() von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/
von Freepik auf der Plattform https://flaticon.com/
Software oder Dokumente, die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden, wie Patente, Marken, eingetragene Muster, Logos und Namen, sind von der Weiterverwendungspolitik des Hofes ausgenommen.
Die Websites der Organe der Europäischen Union in der Domain "europa.eu" enthalten mitunter Links zu von Dritten betriebenen Websites. Da der Hof keinerlei Kontrolle über diese Websites hat, sollten Sie deren Bestimmungen zum Datenschutz und zum Urheberrecht einsehen.
Verwendung des Logos des Hofes
Das Logo des Europäischen Rechnungshofs darf nur mit vorheriger Genehmigung des Hofes verwendet werden.
DIE EU KONTAKTIEREN
Besuch
In der Europäischen Union gibt es Hunderte von „Europa Direkt“-Zentren. Ein Büro in Ihrer Nähe können Sie online finden (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de).
Per Telefon oder schriftlich
Der Europa-Direkt-Dienst beantwortet Ihre Fragen zur Europäischen Union. Kontaktieren Sie Europa Direkt
- über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche Telefondienstanbieter berechnen allerdings Gebühren),
- über die Standardrufnummer: +32 22999696,
- über das folgende Kontaktformular: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_de.
INFORMATIONEN ÜBER DIE EU
Im Internet
Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die Europäische Union in allen Amtssprachen (european-union.europa.eu).
EU-Veröffentlichungen
Sie können EU-Veröffentlichungen einsehen oder bestellen unter op.europa.eu/de/publications. Wünschen Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen Veröffentlichung, wenden Sie sich an Europa Direkt oder das Dokumentationszentrum in Ihrer Nähe (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de).
Informationen zum EU-Recht
Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1951 in sämtlichen Amtssprachen, finden Sie in EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).
Offene Daten der EU
Das Portal data.europa.eu bietet Zugang zu offenen Datensätzen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU. Die Datensätze können zu gewerblichen und nicht gewerblichen Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden. Über dieses Portal ist auch eine Fülle von Datensätzen aus den europäischen Ländern abrufbar.

