
Zollkontrollen: Unzureichende Harmonisierung ist den finanziellen Interessen der EU abträglich
Über den Bericht:
Innerhalb der EU-Zollunion ist eine einheitliche Anwendung der Zollkontrollen durch die Mitgliedstaaten erforderlich, um zu verhindern, dass betrügerische Einführer gezielt Eingangszollstellen mit niedrigerem Kontrollniveau nutzen. Gemäß dem Zollkodex der Union ist die Kommission verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit sichergestellt ist, dass die Mitgliedstaaten die Zollkontrollen einheitlich anwenden. Um dieses Ziel zu erreichen, erließ die Kommission vor Kurzem den Durchführungsbeschluss über gemeinsame Kriterien und Standards für finanzielle Risiken. Dieser Beschluss wird von Leitlinien begleitet, die von den Mitgliedstaaten gebilligt wurden. Die beiden Dokumente bilden zusammen den Rahmen für das finanzielle Risiko im Zollbereich.
Im Zuge dieser Prüfung bewertete der Hof, ob der genannte Beschluss und die zugehörigen Leitlinien, die von der Kommission für die Anwendung in den Mitgliedstaaten entwickelt wurden, so gestaltet waren, dass eine harmonisierte Auswahl von Einfuhranmeldungen für Kontrollen gewährleistet war, und wie die Mitgliedstaaten den Beschluss und die Leitlinien umsetzten.
Der Hof gelangte zu dem Schluss, dass die Umsetzung des neuen Rahmens für das finanzielle Risiko im Zollbereich ein wichtiger Schritt hin zu einer einheitlichen Anwendung der Kontrollen ist. Der Rahmen ist jedoch nicht gut genug gestaltet, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten bei der Auswahl der Kontrollen in harmonisierter Weise vorgehen. Zudem setzen die Mitgliedstaaten den Beschluss und die Leitlinien auf unterschiedliche Weise um.
Der Hof richtet Empfehlungen an die Kommission, damit diese die einheitliche Anwendung von Zollkontrollen verbessert und eine umfassende Analyse- und Koordinierungskapazität auf EU-Ebene entwickelt und umsetzt. Damit Fortschritte erreicht werden können, ist die Unterstützung und gegebenenfalls die Zustimmung der Mitgliedstaaten erforderlich.
Sonderbericht des Hofes gemäß Artikel 287 Absatz 4 Unterabsatz 2 AEUV.
Zusammenfassung
IDie Zollunion der EU wurde vor mehr als 50 Jahren geschaffen. Im Zollbereich ist ausschließlich die EU für die Annahme von Rechtsvorschriften zuständig, während es Aufgabe der Mitgliedstaaten ist, für deren Umsetzung einschließlich Zollkontrollen zu sorgen. Den mitgliedstaatlichen Zollbehörden kommt eine Schlüsselrolle zu, die darin besteht, zwischen der Notwendigkeit, mithilfe schnellerer und nahtloser Einfuhrverfahren den Handel zu erleichtern, und der Notwendigkeit, Zollkontrollen durchzuführen, ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen. Im Jahr 2019 wurden Zölle in Höhe von 21,4 Milliarden Euro erhoben, was 13 % der Einnahmen des EU-Haushalts entspricht.
IIUm zu verhindern, dass betrügerische Einführer gezielt Eingangszollstellen mit niedrigerem Kontrollniveau nutzen, ist eine einheitliche Anwendung der Zollkontrollen durch die Mitgliedstaaten erforderlich. Gemäß der wichtigsten Rechtsgrundlage der EU für den Zollbereich, dem Zollkodex der Union, ist die Kommission seit 2016 verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, damit sichergestellt ist, dass die Mitgliedstaaten die Zollkontrollen einheitlich anwenden. Zur Erreichung dieses Ziels erließ die Kommission im Jahr 2018 den Durchführungsbeschluss über gemeinsame Kriterien und Standards für finanzielle Risiken (Financial Risk Criteria and Standards Implementing Decision – FRC-Beschluss), um die von den Mitgliedstaaten vorgenommene Auswahl von Einfuhren für Kontrollen zu harmonisieren. Dieser Beschluss wird von Leitlinien begleitet, die von den Mitgliedstaaten im Jahr 2019 gebilligt wurden. Die beiden Dokumente (der FRC-Beschluss und die Leitlinien) bilden zusammen den Rahmen für das finanzielle Risiko im Zollbereich. Angesichts der Einführung dieses neuen Rechtsrahmens beschloss der Hof, diese Prüfung durchzuführen.
IIIDer Hof bewertete, ob der von der Kommission entwickelte Rahmen für die Anwendung in den Mitgliedstaaten so gestaltet war, dass eine harmonisierte Auswahl von Einfuhranmeldungen für Kontrollen gewährleistet war, und wie die Mitgliedstaaten diesen Rahmen umsetzten. Die Umsetzung des FRC-Beschlusses und der Leitlinien ist ein wichtiger Schritt hin zu einer einheitlichen Anwendung der Zollkontrollen. Der Rahmen ist jedoch nicht gut genug gestaltet, um sicherzustellen, dass die Mitgliedstaaten bei der Auswahl der Einfuhranmeldungen zur Kontrolle in harmonisierter Weise vorgehen. Zudem setzen die Mitgliedstaaten den Rahmen auf unterschiedliche Weise um.
IVDer FRC-Beschluss enthält keine sachgerechte Definition des Risikobegriffs und ist nicht detailliert genug. Darüber hinaus stellte der Hof fest, dass wichtige Elemente im Rahmen fehlen, beispielsweise eine EU-weite Analyse auf der Grundlage von Daten zu allen EU-Einfuhren, angemessene Techniken der Datenextraktion („Data-Mining“) und geeignete Methoden zur Bewältigung der finanziellen Risiken, die sich bei Einfuhren aus dem elektronischen Handel ergeben. Außerdem enthält der Rahmen keine angemessenen Vorkehrungen zur Überwachung und Überarbeitung seiner Anwendung.
VDie Mitgliedstaaten haben damit begonnen, den Rahmen der Kommission umzusetzen – hauptsächlich indem sie die Kriterien, die sie zuvor verwendet hatten, um auf verdächtige Einfuhren abzuzielen („Risikoprofile“), den entsprechenden Kriterien aus dem Beschluss zuordnen. In den besuchten Mitgliedstaaten hat die Umsetzung des FRC-Beschlusses jedoch zu keiner erheblichen Änderung ihrer Auswahlverfahren für Kontrollen geführt. Der Hof stellte fest, dass die Mitgliedstaaten Risikosignale nicht in gleicher Weise interpretierten, was zu unterschiedlichen Kriterien für die Auswahl von Einfuhren für Kontrollen führte. Er stellte ferner fest, dass die Mitgliedstaaten untereinander nur sehr wenige Informationen über als risikobehaftet eingestufte Einführer austauschten. Dies steht wirksamen und harmonisierten Kontrollauswahlverfahren im Wege.
VIDer Rahmen gestattet es den Mitgliedstaaten, die Zahl der empfohlenen Kontrollen, die sich aus ihrer Risikoanalyse ergeben, auf ein Niveau zu reduzieren, das angesichts ihrer beschränkten Ressourcen machbar ist. Der Hof gelangte zu dem Ergebnis, dass die Mitgliedstaaten keine ähnlichen Verfahren anwendeten, um die Zahl der Kontrollen zu verringern, was dazu führte, dass sie mit ähnlichen Risiken unterschiedlich umgingen. Ferner stellte er fest, dass einige Mitgliedstaaten nicht alle Anmeldungen einer automatisierten Risikoanalyse unterzogen, wie im FRC-Beschluss vorgeschrieben.
VIIDer Hof richtet Empfehlungen an die Kommission, damit diese die einheitliche Anwendung von Zollkontrollen verbessert und eine umfassende Analyse- und Koordinierungskapazität auf EU-Ebene entwickelt und umsetzt.
Einleitung
Die Zollunion ist wichtig für den Handel und die Einnahmen der EU
01Im Jahr 2018 beging die EU den 50. Jahrestag des Bestehens der Zollunion. Grundlage der Zollunion sind die Abschaffung von Zöllen und anderen Handelsbeschränkungen zwischen den teilnehmenden Staaten sowie die Einführung gemeinsamer Zölle auf Einfuhren aus Drittländern. Es handelt sich um einen Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit der EU1, in dem die EU die meisten Zollpolitiken festlegt und Zollvorschriften erlässt. Die Verantwortung für die Umsetzung des Zollrechts liegt jedoch in erster Linie bei den Mitgliedstaaten2 und umfasst die Erhebung von Zöllen für die EU und die Durchführung von Zollkontrollen.
02Die EU ist auf den effizienten Güterstrom in die und aus der Zollunion angewiesen. Den jüngsten verfügbaren Statistiken zufolge3 belief sich der Wert der Ein- und Ausfuhren der EU im Jahr 2019 zusammengenommen auf etwa 4 Billionen Euro (das entspricht rund 25 % des BIP der EU). Dies führt vor Augen, wie stark sich der internationale Handel auf die Wirtschaftstätigkeit der EU auswirkt, und welche Bedeutung die Zollunion hat. Abbildung 1 zeigt die wichtigsten Ursprungsländer der EU-Einfuhren und die wichtigsten eingeführten Waren.
Abbildung 1
Wareneinfuhren in die EU 2019: wichtigste Länder, die in die EU ausführen

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Eurostat Comext, Datensatz „EU-Handel nach HS2,4,6 und CN8 seit 1988 (DS-045409)“.
Darüber hinaus sind Einfuhrzölle eine wichtige Einnahmequelle für den Haushalt der EU; im Jahr 2019 beliefen sie sich auf 21,4 Milliarden Euro (13 % aller EU-Einnahmen). Abbildung 2 zeigt die Werte der Einfuhren der Mitgliedstaaten im Jahr 2019, die Zölle, die sie an den EU-Haushalt abführten, sowie die 20 %, die sie zur Deckung ihrer Erhebungskosten einbehielten.
Abbildung 2
EU-Einfuhren und erhobene Zölle im Jahr 2019

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Eurostat Comext, Datensatz „EU-Handel nach HS2,4,6 und CN8 seit 1988 (DS-045409)“; Jahresrechnung der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019.
Eine Risikoanalyse und die einheitliche Anwendung der Zollkontrollen sind für eine wirksame Erhebung der Einfuhrabgaben entscheidend
04Die Zollbehörden der Mitgliedstaaten sind zuständig für die Erhebung von Zöllen, Verbrauchsteuern und der bei der Einfuhr fälligen Mehrwertsteuer (MwSt.). Darüber hinaus verfolgen sie mehrere andere Ziele – wie die Verbesserung der inneren Sicherheit der EU, den Schutz der EU vor unlauterem und illegalem Handel und den Schutz der Umwelt. Die Terrorismusbekämpfung ist für die Zollbehörden zu einer Priorität geworden.
05Für die Zollbehörden ist es eine Herausforderung, zwischen der Notwendigkeit, mithilfe schnellerer und nahtloser Einfuhrverfahren den Handel zu erleichtern, und der Notwendigkeit, Zollkontrollen durchzuführen, ein ausgewogenes Verhältnis zu schaffen und dabei die in ihrem Mitgliedstaat verfügbaren Ressourcen zu berücksichtigen. Bei einer früheren Prüfung4 stellte der Hof fest, dass ein Negativanreiz die Mitgliedstaaten von der Durchführung von Zollkontrollen abhält. Dies liegt daran, dass die Mitgliedstaaten, die Zollkontrollen durchführen, häufig die finanziellen Folgen ihres Handelns tragen, wenn es ihnen nicht gelingt, Erhebungen bei den Einführern vorzunehmen. Mitgliedstaaten, die solche Kontrollen nicht durchführen, können negative Folgen möglicherweise vermeiden. Um ihre Tätigkeiten zu optimieren, geben Einführer womöglich Eingangszollstellen mit weniger Kontrollen den Vorzug.
06Im Zollkodex der Union (UZK)5 ist „Risiko“6 definiert als „die Wahrscheinlichkeit, dass […] ein Ereignis und die Auswirkungen eintreten, durch die a) die vorschriftsmäßige Anwendung von Maßnahmen der Union oder ihrer Mitgliedstaaten verhindert wird, b) die finanziellen Interessen der Union und ihrer Mitgliedstaaten bedroht werden oder c) die Sicherheit und der Schutz der Union und ihrer Bewohner, die Gesundheit von Menschen, Tieren oder Pflanzen, die Umwelt oder die Verbraucher gefährdet werden“. Finanzielle Risiken sind solche, durch die die finanziellen Interessen der EU und ihrer Mitgliedstaaten bedroht werden.
07Die Weltzollorganisation (WZO) weist in ihrem Risikomanagementkompendium darauf hin, dass zur Bestimmung des Risikoniveaus eine Analyse der Wahrscheinlichkeit sowie der potenziellen Folgen und der Größenordnung durchgeführt werden sollte7. Risikoanalyse ist definiert als die systematische Nutzung verfügbarer Informationen zur Bestimmung der Häufigkeit des Auftretens definierter Risiken und der Größenordnung ihrer wahrscheinlichen Folgen. Sie spielt eine Schlüsselrolle bei der Bewertung der Frage, wie die knappen Ressourcen der Zollbehörden zugewiesen werden sollten, um die Risiken, einschließlich finanzieller Risiken, mit Zollkontrollen bestmöglich abzudecken.
08Zollkontrollen können sich hinsichtlich folgender Aspekte unterscheiden:
- Zeitpunkt: Kontrollen vor oder bei der Überlassung werden vor der Einfuhrabfertigung durchgeführt, nachträgliche Kontrollen dagegen im Anschluss, was bedeutet, dass sie den Handelsfluss weniger stören;
- Art: Prüfungen von Unterlagen erstrecken sich auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Gültigkeit der Zollanmeldungen, während bei Warenbeschauen auch die Waren selbst untersucht werden, einschließlich der Zählung und der Entnahme von Proben, um festzustellen, ob sie mit der Zollanmeldung übereinstimmen.
Jeder Mitgliedstaat verfügt im Zollbereich über ein eigenes Risikomanagementverfahren, das auf spezifischen Merkmalen beruht und von mehreren eingegebenen Informationen abhängt. Im Allgemeinen folgen die Verfahren jedoch dem in Abbildung 3 dargestellten Schema.
Abbildung 3
Typischer Risikomanagementprozess in den Mitgliedstaaten

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von in den Mitgliedstaaten eingeholten Informationen.
In den vergangenen Jahren hat der Hof bei mehreren Gelegenheiten erhebliche Risiken und Probleme im Zusammenhang mit Zollkontrollen festgestellt. Er gelangte zu dem Schluss, dass der Vorläufer des UZK, der Zollkodex der Gemeinschaften8, den Mitgliedstaaten in ihrer Strategie für nachträgliche Prüfungen einen übermäßigen Ermessensspielraum einräumte9, dass die Wettbewerbsbedingungen für die Häfen in der EU nicht gleich waren10 und dass eine uneinheitliche Anwendung der Zollkontrollen durch die Mitgliedstaaten es betrügerischen Wirtschaftsbeteiligten ermöglichte, gezielt spezifische Eingangszollstellen zu nutzen11. In ihrer Antwort auf die Bemerkungen des Hofes erklärte die Kommission, die gemeinsamen Kriterien und Standards der EU für finanzielle Risiken würden die vom Hof ermittelten Schwachstellen beseitigen. Diese Kriterien und Standards wurden seinerzeit erarbeitet. Die von der Kommission erhobenen Statistiken zeigen, dass das Maß an Kontrollen von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat sehr stark variiert: Es reicht von weniger als 1 % der Einfuhranmeldungen in einigen Ländern bis hin zu mehr als 60 % in anderen, wie Abbildung 4 zeigt.
Abbildung 4
Prozentualer Anteil der im Jahr 2019 von den Mitgliedstaaten zum Zeitpunkt der Überlassung durchgeführten Kontrollen von Standardanmeldungen (Prüfungen von Unterlagen und Warenbeschauen)

Die Zahlen umfassen Prüfungen, die eingeleitet wurden, um sowohl finanzielle als auch Sicherheitsrisiken abzudecken.
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von Informationen, die die Mitgliedstaaten für die Erstellung der Berichte über die Leistung der Zollunion 2019 durch die Kommission zur Verfügung gestellt haben.
Bei nicht angemeldeten und falsch angemeldeten Einfuhren, die den Zollkontrollen entgangen sind, entsteht eine „Zolllücke“ – die Differenz zwischen den tatsächlich erhobenen Einfuhrabgaben und dem Betrag, der theoretisch hätte erhoben werden sollen12. So führte beispielsweise ein kürzlich aufgetretener Betrugsfall im Vereinigten Königreich, das keine angemessenen Maßnahmen ergriff, um das Risiko der Unterbewertung von Textil- und Schuheinfuhren zu mindern, zu potenziellen Zollverlusten, die sich für den Zeitraum November 2011 bis Oktober 2017 Berechnungen der Kommission zufolge auf 2,7 Milliarden Euro belaufen (die Kommission hat diesen Betrag in der Jahresrechnung der EU ausgewiesen).
12Im Jahr 2017 empfahl der Hof13 der Kommission, gemeinsam mit den Mitgliedstaaten eine Schätzung der Zolllücke vorzunehmen, was jedoch nie erfolgt ist. Darüber hinaus enthielt der Jährliche Tätigkeitsbericht 2019 der Generaldirektion Haushalt (GD BUDG) der Kommission einen Vorbehalt bezüglich der Unrichtigkeit der Beträge der dem EU-Haushalt zugeführten traditionellen Eigenmittel (TEM). Dieser Vorbehalt deckte den Fall des Vereinigten Königreichs und nicht quantifizierte potenzielle TEM-Verluste in anderen Mitgliedstaaten ab. Lücken in der Erhebung von Zöllen müssen durch höhere Beiträge der Mitgliedstaaten auf der Grundlage des Bruttonationaleinkommens (BNE) ausgeglichen werden, die letztlich von den europäischen Steuerzahlern getragen werden.
Die einheitliche Anwendung von Zollkontrollen ist eine rechtliche Anforderung
13Mit dem UZK, der im Mai 2016 in Kraft trat, wurde die einheitliche Anwendung der Zollkontrollen zu einer rechtlichen Anforderung: Gemäß UZK ist die Kommission für die Festlegung gemeinsamer Risikokriterien und Standards zuständig. Dementsprechend erließ die Kommission nach Konsultation der Mitgliedstaaten im Mai 2018 einen Durchführungsbeschluss, in dem spezifische Anforderungen an das Risikomanagement festgelegt sind: den Durchführungsbeschluss über gemeinsame Kriterien und Standards für finanzielle Risiken (Financial Risk Criteria and Standards Implementing Decision, „FRC-Beschluss“)14. Es handelt sich um ein nicht öffentliches EU-Dokument („EU restricted“). Mit diesem Beschluss wurde den Mitgliedstaaten etwas mehr Zeit gewährt, um sicherzustellen, dass die erforderliche Technik zur elektronischen Datenverarbeitung vorhanden war. Erstmals wurden außerdem in einem rechtsverbindlichen Durchführungsbeschluss gemeinsame Risikokriterien und Standards zur Bewältigung finanzieller Risiken festgelegt.
14Mit dem FRC-Beschluss sollen die Verfahren der Mitgliedstaaten zur Risikoanalyse und zur Auswahl von Einfuhren für Kontrollen harmonisiert werden15. Er erstreckt sich weder auf die Verfahren für die Durchführung von Kontrollen noch auf die Qualität und die Ergebnisse der Kontrollen (siehe Abbildung 5).
Abbildung 5
Bereiche, auf die sich der FRC-Beschluss bezieht

Quelle: Europäischer Rechnungshof.
Darüber hinaus erstellten die Kommission (Generaldirektion Steuern und Zollunion (GD TAXUD)) und eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der nationalen Zollbehörden Leitlinien zur Ergänzung des FRC-Beschlusses. Diese Leitlinien, die schließlich im Dezember 2019 von den Mitgliedstaaten gebilligt wurden, sind ebenfalls als „EU restricted“ eingestuft. Sie sind nicht rechtsverbindlich und daher nicht durchsetzbar. Die beiden Dokumente (der FRC-Beschluss und die Leitlinien) bilden zusammen den Rahmen, den die Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten entwickelt hat, um die gemäß UZK erforderlichen gemeinsamen Kriterien und Standards für finanzielle Risiken festzulegen.
16Im Juli 2019 bekundete die Kommission von der Leyen ihre Absicht, die Zollunion zu stärken, und zwar insbesondere durch „ein umfangreiches integriertes Maßnahmenpaket zur Stärkung des Zollrisikomanagements und zur Unterstützung wirksamer Kontrollen der Mitgliedstaaten“16. Im September 2020 legte die GD TAXUD einen Aktionsplan zur Verbesserung der Funktionsweise der Zollunion vor17. Dies erfolgte nach Abschluss der Prüfung des Hofes.
Prüfungsumfang und Prüfungsansatz
17Im Lichte des neuen Rechtsrahmens (siehe Ziffern 13-15) beschloss der Hof, diese Prüfung durchzuführen. Die Prüfung erstreckte sich auf die Festlegung gemeinsamer Kriterien und Standards für finanzielle Risiken durch die Kommission sowie auf die Art und Weise, wie die Mitgliedstaaten diese Kriterien und Standards anwenden. Der Hof analysierte, ob der von der Kommission für die Umsetzung in den Mitgliedstaaten entwickelte Rahmen (FRC-Beschluss und Leitlinien) eine einheitliche Anwendung der Zollkontrollen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU gewährleistete. Zu diesem Zweck bewertete er, ob der Rahmen angemessen war und wie die Mitgliedstaaten ihre Risikomanagementsysteme zur Auswahl der zu kontrollierenden Einfuhranmeldungen nutzten. Der Hof untersuchte alle Schritte, die der Auswahl von Einfuhranmeldungen zur Kontrolle vorangingen, sowie die Weiterverfolgung dieser Kontrollen. Die Qualität der Zollkontrollen und ihre Ergebnisse waren nicht Teil des Prüfungsumfangs.
18Der Hof verglich den Rahmen der Kommission mit einschlägigen internationalen Normen und bewährten Verfahren (d. h. denjenigen der WZO18 und der Internationalen Organisation für Normung (ISO) 31000:2018 Risikomanagement – Leitlinien), um seine Eignung zur Gewährleistung einer einheitlichen Anwendung der Zollkontrollen zu bewerten. Ferner untersuchte der Hof, ob die Kommission über ausreichende Vorkehrungen zur Überwachung, Überarbeitung und Berichterstattung verfügte.
19Der Hof besuchte die Zollbehörden von fünf Mitgliedstaaten und bewertete, wie die gemeinsamen Kriterien und Standards für finanzielle Risiken im Rahmen ihrer Risikomanagementsysteme bei der Auswahl für Zollkontrollen verwendet wurden. Er wählte diese Mitgliedstaaten unter Berücksichtigung von zwei Kriterien aus: der Höhe der erhobenen Zölle und seiner eigenen qualitativen Risikobewertung. Ferner analysierte er, ob die Verfahren der Mitgliedstaaten zu einer einheitlichen Anwendung der Zollkontrollen führten. Darüber hinaus übermittelte er den Zollbehörden aller EU-Mitgliedstaaten einen Fragebogen, um Informationen darüber einzuholen, wie sie das derzeitige Niveau der Harmonisierung der Zollkontrollen einschätzen. Alle 27 Mitgliedstaaten beantworteten den Fragebogen. Der Hof bat um ihre Ansicht zur Angemessenheit des Rahmens und um Angaben dazu, inwieweit sie die gemeinsamen Kriterien und Standards für finanzielle Risiken umgesetzt hatten.
20Die Prüfbesuche fanden zwischen Oktober 2019 und Januar 2020 statt, d. h. nach Ablauf der Frist, innerhalb derer die Mitgliedstaaten gemäß FRC-Beschluss sicherstellen mussten, dass die Kriterien für die automatisierte Risikoanalyse erfüllt waren. In diesem Zeitraum wurden die Leitlinien, die die für die Umsetzung des FRC-Beschlusses erforderlichen technischen Elemente enthalten, noch erörtert und waren daher in den Mitgliedstaaten noch nicht anwendbar. Sie wurden im Dezember 2019 formell angenommen.
Bemerkungen
Der Rahmen für das Risikomanagement weist Schwachstellen auf
Der Risikobegriff ist im FRC-Beschluss nicht sachgerecht definiert
21Der Hof stellte fest, dass die Definition des Risikobegriffs im FRC-Beschluss Schwachstellen aufweist. Dies kann dazu führen, dass die Zollbehörden der Mitgliedstaaten Kontrollen von Einfuhren, die mit einem hohen Risiko für die finanziellen Interessen der EU verbunden sind, nicht priorisieren.
Die Vorschriften für die Mitgliedstaaten sind nicht streng genug
22Im UZK sind die Anforderungen bezüglich der gemeinsamen Risikokriterien und Standards aufgeführt, die in den Mitgliedstaaten anzuwenden sind (siehe Kasten 1).
Kasten 1
Die gemeinsamen Risikokriterien und Standards
Gemäß dem Zollkodex der Union19 umfassen die gemeinsamen Risikokriterien und Standards die folgenden Elemente:
- eine Beschreibung der Risiken,
- die Risikofaktoren oder -indikatoren, die bei der Auswahl von Waren oder Wirtschaftsbeteiligten für Zollkontrollen zu berücksichtigen sind,
- die Art der von den Zollbehörden durchzuführenden Zollkontrollen,
- die Dauer der Anwendung der unter Buchstabe c genannten Zollkontrollen.
Im FRC-Beschluss sind eine Reihe von Kriterien für finanzielle Risiken und Risikoindikatoren aufgeführt, die von den Mitgliedstaaten bei der Auswahl für Kontrollen zu verwenden sind. Bei den im FRC-Beschluss genannten Kriterien handelt es sich um die Risikobereiche, die von den Mitgliedstaaten einheitlich angegangen werden müssen. Ein Risikoindikator ist ein spezifisches Datenelement oder eine Information über das Bestehen eines Risikos. Im Allgemeinen wird ein spezifisches Risiko auf der Grundlage einer Kombination von Risikoindikatoren ermittelt.
24Der Hof stellte fest, dass für die Indikatoren keine hinreichend strengen Vorschriften bezüglich der Aktivierung der Kontrollen gelten, was dazu führt, dass die Mitgliedstaaten sie auf unterschiedliche Weise anwenden können. Der Grund dafür ist, dass die Beschreibung der Risikokriterien keine näheren Angaben zu den Umständen enthält, durch die ein Indikator aktiviert werden und somit die Auswahl erfolgen sollte. Dies wirkt sich auf die Risikoprofile aus, bei denen es sich um eine Kombination von Kriterien handelt, die bei Anwendung auf eine Zollanmeldung zu einer Kontrollempfehlung führen können (siehe Abbildung 3). Die Risikoprofile können in den einzelnen Mitgliedstaaten unterschiedliche Aktivierungskriterien enthalten, d. h., sie gewährleisten keine harmonisierte Auswahl von Anmeldungen zur Kontrolle. Da außerdem die für jedes Kriterium aufgeführte Liste der Risikoindikatoren nicht verpflichtend ist, steht es den Mitgliedstaaten frei, sie (einzeln oder kombiniert) nach eigenem Ermessen zu verwenden.
25Der FRC-Beschluss enthält keine spezifischen Vorschriften über Art und Dauer der Zollkontrollen. Er überlässt es den mitgliedstaatlichen Zollbehörden, über die zu ergreifende Kontroll- oder Überprüfungsmaßnahme zu entscheiden. Darüber hinaus ist nicht festgelegt, wie die Risikokriterien und ‑indikatoren für die Auswahl von Anmeldungen (oder zu prüfenden Unternehmen) für nachträgliche Kontrollen anzuwenden sind.
26Die Leitlinien sind darauf ausgerichtet, eine gemeinsame Auslegung des FRC-Beschlusses vorzugeben. Sie enthalten eine Beschreibung der Risikobereiche und Angaben dazu, wie die verschiedenen Indikatoren kombiniert werden sollen, um das Gesamtrisiko zu ermitteln. Außerdem umfassen sie einige qualitative Hinweise zur Bewertung von Risikoindikatoren. Es fehlen jedoch ausführliche Beschreibungen mit quantifizierbaren Indikatoren, die von den Zollbehörden der Mitgliedstaaten bei ihren Risikoanalysen verwendet werden könnten. So enthalten sie zwar einige Beispiele dafür, wie die Mitgliedstaaten einen risikobehafteten Händler oder „Wirtschaftsbeteiligten von Interesse“ ermitteln könnten, schreiben aber keine genaue Methodik vor, um sicherzustellen, dass alle Mitgliedstaaten diesen Risikoindikator auf die gleiche Weise definieren.
27Der FRC-Beschluss gestattet es den Mitgliedstaaten zu entscheiden, wie die Zahl der Kontrollen auf ein Maß reduziert werden kann, das auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen zu bewältigen ist. Diese Möglichkeit wird als „Steuerung der Auswirkungen“ bezeichnet. Im FRC-Beschluss ist vorgesehen, wie die Mitgliedstaaten die Auswirkungen steuern können. Die Methoden zur Steuerung der Auswirkungen werden in der Regel angewendet, wenn ein Risikoprofil erstellt wird, wobei die Schätzungen eines Risikoanalysten zum Tragen kommen (siehe auch Abbildung 3).
28Im FRC-Beschluss ist keine Begrenzung der Steuerung der Auswirkungen festgelegt, wodurch den Mitgliedstaaten bei der Verringerung der Zahl der Kontrollen erheblicher Ermessensspielraum eingeräumt wird. Für mehrere Risikokriterien werden in den Leitlinien Situationen genannt, in denen die Zahl der Kontrollen nicht oder nur dann verringert werden sollte, wenn die Gründe klar erläutert werden. Selbst wenn die Kontrollen nicht reduziert werden sollten, lassen die Leitlinien jedoch Ausnahmen zu, ohne diese Fälle konkret zu definieren.
29Zusätzlich zur Steuerung der Auswirkungen können die Zollbehörden entscheiden, die vom automatisierten System empfohlenen Kontrollen nicht durchzuführen. Dies wird als „Außerachtlassung“ („override“) der Empfehlung bezeichnet (siehe auch Abbildung 3). Der FRC-Beschluss enthält keine ausreichenden Vorschriften, um bei der Außerachtlassung Kohärenz zu gewährleisten. In den Leitlinien wird die Praxis der Mitgliedstaaten anerkannt, Kontrollempfehlungen außer Acht zu lassen. Gleichzeitig wird festgestellt, dass eine Außerachtlassung in Fällen mit hohem Risiko nicht wünschenswert ist und dass alle Fälle dokumentiert und erläutert werden sollten. Es werden keine spezifischen Angaben dazu gemacht, wann eine Außerachtlassung akzeptabel ist.
Dem Rahmen fehlen wichtige Merkmale eines wirksamen Risikomanagementsystems
30Der UZK, das Risikomanagementkompendium der WZO und die ISO-Norm 31000 enthalten die Grundsätze und Merkmale, die in einem Zollrisikomanagementsystem vorhanden sein sollten. Der Hof stellte fest, dass der EU-Rahmen die folgenden Kernmerkmale eines wirksamen Risikomanagementsystems nicht aufweist:
- Risikoanalyse auf EU-Ebene;
- Data-Mining (sowohl auf EU-Ebene als auch auf Ebene der Mitgliedstaaten);
- harmonisierter Ansatz für die Zufallsauswahl von Anmeldungen zur Kontrolle;
- Plattformen für den Austausch von Informationen über alle risikobehafteten Einführer;
- geeignete Methoden zur Bewältigung finanzieller Risiken im Zusammenhang mit Einfuhren aus dem elektronischen Handel (hohe Zahl von Einfuhranmeldungen mit geringem Zollwert).
Verschiedene Risiken können entweder auf nationaler Ebene oder auf EU-Ebene besser ermittelt und angegangen werden, und ein wirksamer Risikomanagementrahmen sollte diesen Risiken auf der am besten geeigneten Ebene begegnen. Da die EU eine Zollunion ist (in der die Einführer ihren Einfuhrort frei wählen können), wäre eine Analyse auf EU-Ebene besser geeignet, um EU-weite Risiken zu ermitteln und zu bekämpfen. Wie die WZO hervorhebt, ermöglichen Risikobewertungszentren/Zentren für die Zielausrichtung („risk assessment/targeting centres“) den Zollbehörden die dynamische Ermittlung der Transaktionen, bei denen die Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes gegen die Vorschriften am größten ist, sodass sie wirksamer auf die Situationen mit dem höchsten Risiko reagieren können20.
32Gemäß dem FRC-Beschluss sind die Mitgliedstaaten dafür zuständig, Risikoanalysen durchzuführen und alle Entscheidungen über die Relevanz von EU- und nationalen Daten für die Zwecke ihrer eigenen Risikomanagementsysteme zu treffen. Während auf nationaler Ebene häufig Risikobewertungszentren eingerichtet wurden, hat die EU kein operatives Zentrum geschaffen, um finanzielle Risiken auf EU-Ebene anzugehen. In ihrem Zollaktionsplan vom 28. September 2020 (siehe Ziffer 16) erkannte die Kommission an, dass eine Datenanalyse auf EU-Ebene eingeführt werden muss, um die gesamte Struktur zu festigen.
33Data-Mining ist ein Prozess zur Entdeckung interessanter und nützlicher Muster und Zusammenhänge in großen Datenmengen. Sowohl die ISO-Norm 3100021 als auch die WZO unterstreichen die Bedeutung des Data-Mining im Risikomanagementprozess. Data-Mining ist wirksamer, wenn größere Datenmengen verfügbar sind. Der Rahmen enthält jedoch keine Anforderung, wonach eine EU-weite Analyse auf der Grundlage der Daten aller EU-Einfuhren durchzuführen ist. Die Kommission hat solche Analysen nicht systematisch durchgeführt, um finanzielle Risiken im Zollwesen aufzudecken. Sie leitete das Pilotprojekt „Joint Analysis Capacity“ (JAC) ein, um auf EU-Ebene Datenanalysen durchzuführen. Wie in Kasten 2 beschrieben, handelte es sich bei dem JAC-Projekt um eine begrüßenswerte Initiative, die jedoch in Bezug auf Umfang, Kapazität und Outputs begrenzt war.
Kasten 2
JAC-Pilotprojekt
Entsprechend den Empfehlungen des Hofes22 und des Europäischen Parlaments haben die GD BUDG, die GD TAXUD und das Betrugsbekämpfungsamt der EU (OLAF) das JAC-Pilotprojekt zur Analyse der Handelsströme ins Leben gerufen. Sein Anwendungsbereich beschränkte sich auf die Analyse der Einfuhren bestimmter Waren, was im Jahr 2019 zur Erstellung von acht EU-Risikoinformationsformularen (RIF) führte (siehe Ziffer 53). Die Kommission erwartete, dass die Mitgliedstaaten auf dieser Grundlage Risikoprofile erstellen oder aktualisieren würden. Die Weiterverfolgung der Ergebnisse dieser RIF ist noch im Gange.
Im September 2020 veröffentlichte die Kommission einen Zollaktionsplan (siehe Ziffer 16), in dem sie eine EU-Initiative für „Gemeinsame Analysekapazitäten“ („Joint Analytics Capabilities“) vorschlug. Im Rahmen dieser Initiative sollen zunächst vor allem Daten genutzt werden, die bereits verfügbar sind, und geeignete Governance-Lösungen entwickelt werden.
Der FRC-Beschluss verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, in ihrer Risikoanalyse Data-Mining-Techniken zu verwenden. In den Leitlinien werden sie als Möglichkeit erwähnt, ohne dass eine klare Methodik festgelegt wird. Ein Drittel der Mitgliedstaaten gab in der Antwort auf den Fragebogen des Hofes an, dass im EU-Rahmen für finanzielle Risiken fortschrittliche Datenanalysetechniken (d. h. Data-Mining) nicht ausreichend berücksichtigt würden. Zwei der besuchten Mitgliedstaaten erstellten Risikoprofile, die sich aus Untersuchungen mithilfe von Data-Mining ergaben (wobei Informationen verwendet wurden, die überwiegend aus nationalen Datenbanken stammten). Diese Profile waren bei der Aufdeckung von Unregelmäßigkeiten sehr wirksam. Die drei anderen besuchten Mitgliedstaaten wendeten diese Techniken bei ihrer Risikobewertung jedoch nicht an.
35Von den nicht automatisch anhand von Risikoprofilen ausgewählten Anmeldungen wählen die Mitgliedstaaten einen bestimmten Prozentsatz nach dem Zufallsprinzip für Kontrollen aus. Eine solche Zufallsauswahl ist der Schlüssel zur Gewährleistung eines wirksamen Kontrollrahmens, da so u. a. neue, unerkannte Risikosignale ermittelt werden23. Im FRC-Beschluss wird die Bedeutung von Zufallskontrollen unterstrichen, er enthält jedoch keine Vorschriften zur Harmonisierung des Anteils der von den Mitgliedstaaten ausgewählten Einfuhren oder der von ihnen angewendeten Methode. Die Leitlinien enthalten keine zusätzlichen Anweisungen dazu, wie die Mitgliedstaaten die Zufallsauswahl vornehmen sollten.
36Die vorhandene Plattform, das Zollrisikomanagementsystem (Customs Risk Management System, CRMS), ist für den systematischen Austausch von Informationen über risikobehaftete Einführer zwischen den Mitgliedstaaten nicht gut geeignet. Daher verfügt jeder Mitgliedstaat nur über Informationen über die Einführer, die er selbst als risikobehaftet eingestuft hat. Da Einführer leicht den Ort wechseln können, an dem sie Einfuhren abfertigen lassen, können Einführer, die in einem Mitgliedstaat als risikobehaftet erachtet werden, Einfuhren stattdessen in anderen Mitgliedstaaten abfertigen lassen, in denen dies nicht der Fall ist, und somit Kontrollen umgehen.
37Der elektronische Handel24 stellt eine Herausforderung für das Zollrisikomanagement dar. Da es sich um eine große Menge an Transaktionen mit geringem Wert handelt, sind Kontrollen jeder einzelnen Einfuhranmeldung (für jedes einzelne Paket ist eine Zollanmeldung erforderlich) nicht kosteneffizient. Das Risiko von Unregelmäßigkeiten ist jedoch wahrscheinlich erheblich, und die hohe Zahl solcher Einfuhren bedeutet, dass die Auswirkungen auf die finanziellen Interessen der EU beträchtlich wären. Der durch den FRC-Beschluss und die Leitlinien geschaffene Rahmen trägt diesem Phänomen nicht ausreichend Rechnung: Risikoprofile werden auf jede Transaktion (Einfuhr) angewendet, und die Mitgliedstaaten können die Steuerung der Auswirkungen nutzen, um die Zahl der Transaktionen, die Kontrollen unterzogen werden, zu verringern (siehe Ziffern 27-28). Die Kommission hat in ihrem Zollaktionsplan (siehe Ziffer 16) anerkannt, dass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um wirksamere Zollkontrollen bei Einfuhren im Rahmen des elektronischen Handels zu gewährleisten. Globale Trends im elektronischen Handel deuten darauf hin, dass die Zahl der Einfuhranmeldungen mit geringem Zollwert steigen wird.
Der Rahmen umfasst hinsichtlich der Berichterstattung, Überwachung und Überarbeitung nur begrenzte Anforderungen
38Im FRC-Beschluss sind regelmäßige Zeitabstände festgelegt, in denen die Mitgliedstaaten der Kommission über die Anwendung der gemeinsamen Kriterien für finanzielle Risiken Bericht erstatten müssen. Der Hof stellte fest, dass diese Berichtszeiträume für die Aufrechterhaltung eines wirksamen und aktuellen Systems möglicherweise zu lang sind, da der Rahmen ständig überwacht und überarbeitet werden muss. Zwei der besuchten Mitgliedstaaten bezweifelten ebenfalls, dass diese Abstände rechtzeitigen Maßnahmen zur Verbesserung der gemeinsamen Risikokriterien förderlich sind.
39Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission im Rahmen der Berichterstattung über die Leistung der Zollunion („Customs Union Performance“, CUP) jährlich Informationen über ihre Kontrollen. Die CUP-Berichte könnten der Kommission bei der Überwachung der Umsetzung des FRC-Beschlusses durch die Mitgliedstaaten als Unterstützung dienen. Sie sind jedoch nicht sehr hilfreich, was vor allem daran liegt, dass bei den Informationen über Kontrollen nicht zwischen Kontrollen aus finanziellen Gründen und Kontrollen aus Sicherheitsgründen unterschieden wird. Darüber hinaus ermöglichen die erhobenen Indikatoren keine Bewertung der Wirksamkeit von Maßnahmen oder Profilen für spezifische Risikobereiche.
40Die WZO weist in ihrem Risikomanagementkompendium darauf hin, dass es zu einem langfristig wirksamen Risikomanagement beiträgt, wenn sichergestellt wird, dass die Risikomanagementtätigkeiten überwacht und überarbeitet werden und die Ergebnisse auf die politische Ebene zurückfließen (siehe Abbildung 6).
Abbildung 6
Überwachung und Überarbeitung als Teil des Risikomanagementprozesses

Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage des Risikomanagementkompendiums der WZO.
Bis Oktober 2020 hatte die Kommission (GD TAXUD) kein Verfahren zur regelmäßigen Überwachung der Anwendung des Rahmens durch die Mitgliedstaaten eingeführt. Die GD BUDG besucht die Mitgliedstaaten regelmäßig, um Kontrollen zu den Zollabgaben durchzuführen. Derzeit ist jedoch nicht geplant, dass sich diese Kontrollen auch auf die Umsetzung des FRC-Beschlusses durch die Mitgliedstaaten erstrecken sollen. Außerdem gibt es keine Verfahren, mit denen die Kommission gegen die Nichteinhaltung des FRC-Beschlusses durch die Mitgliedstaaten vorgehen könnte. In Kasten 3 ist ein konkreter Fall dargestellt, der Dänemark betrifft.
Kasten 3
Geringe Zahl von Zollkontrollen in Dänemark von der Kommission nicht angemessen weiterverfolgt
Im Anschluss an eine Kontrolle in Dänemark konstatierte die GD BUDG im Jahr 2010, dass nur sehr wenige Kontrollen durchgeführt wurden. Dieses Problem veranlasste die GD BUDG zu einer Feststellung, die bis 2015 weiterverfolgt, dann aber als erledigt eingestuft wurde, obwohl in Dänemark keine bedeutenden Verbesserungen erfolgt waren und es wahrscheinlich war, dass das Problem die Umsetzung des FRC-Beschlusses beeinträchtigen würde. Seitdem hat die Kommission die dänischen Zollbehörden in dieser Angelegenheit nicht offiziell kontaktiert.
Darüber hinaus veröffentlichte der dänische Rechnungshof (Rigsrevisionen) im Jahr 2017 einen Bericht25, in dem die Kritik der Kommission aus dem Jahr 2010 weiterverfolgt wurde. Daraus ergab sich unter anderem, dass die Zahl der Zollkontrollen nach wie vor sehr gering war, dass das Risikomanagementsystem mehrere Mängel aufwies und dass keine Zufallskontrollen durchgeführt wurden.
Bei EU-Risikoinformationsformularen (EU-RIF) handelt es sich um Online-Formulare, über die die Kommissionsdienststellen Risikosignale mit den Mitgliedstaaten austauschen (siehe Ziffer 53). Auch wenn die Mitgliedstaaten rechtlich nicht verpflichtet sind, Rückmeldungen zu diesen Formularen zu geben, ist eine angemessene Weiterverfolgung der EU-RIF wichtig, um ein kohärentes Risikomanagement zu gewährleisten. Abgesehen von den Arbeiten, die im Rahmen des JAC-Pilotprojekts (siehe Kasten 2) durchgeführt wurden, und den Kontrollen der GD BUDG zu den Zollabgaben in ausgewählten Mitgliedstaaten hat die Kommission nicht weiterverfolgt, ob die Mitgliedstaaten den in den EU-RIF ermittelten Risiken angemessen Rechnung trugen. Die Kommission analysierte die Rückmeldungen der Mitgliedstaaten nicht regelmäßig und unternahm keine Schritte, um gegen das Nichttätigwerden bestimmter Mitgliedstaaten vorzugehen.
43Die Analyse des Hofes zeigt, dass im Jahr 2019 drei Mitgliedstaaten keinerlei Rückmeldung gaben und vier Mitgliedstaaten nur zu einigen wenigen EU-RIF Rückmeldungen übermittelten. In fast der Hälfte (43 %) der Fälle, in denen die Mitgliedstaaten Rückmeldungen gaben, teilten sie nicht mit, ob sie ein Risikoprofil erstellt oder aktualisiert hatten, um das im EU-RIF beschriebene Problem anzugehen, oder ob sie für das Problem bereits über ein Risikoprofil verfügten.
44Um ein wirksames Zollrisikomanagement zu gewährleisten, sind geeignete Vorkehrungen zur Überarbeitung wichtig, damit die Funktionsweise des Rahmens verbessert wird. In diesem Zusammenhang erklärt die WZO, dass ein robuster Rahmen mit Kriterien für die Überarbeitung entworfen werden sollte und dass diese Evaluierungen alle Elemente des Risikomanagements abdecken sollten.
45Zur Erörterung von Fragen im Zusammenhang mit dem Zollrisikomanagement in der EU wurde eine Expertengruppe eingesetzt, der Vertreter der Zollbehörden aller Mitgliedstaaten und der Kommission angehören. Gemäß den Leitlinien sollte diese Gruppe wann immer nötig die wichtigsten die Umsetzung des Rahmens betreffenden Punkte überarbeiten. Die Kommission hat jedoch für die Überarbeitung des FRC-Beschlusses und der Leitlinien noch keine klare Strategie mit Etappenzielen und Kriterien entwickelt.
Der Rahmen führt nicht zu einer einheitlichen Anwendung der Zollkontrollen
In den Mitgliedstaaten gibt es nach wie vor unterschiedliche Verfahren im Bereich des Risikomanagements
46Die fünf besuchten Mitgliedstaaten waren der Ansicht, dass die Risikomanagementsysteme, die sie vor der Einführung des FRC-Beschlusses entwickelt hatten, bereits weitgehend mit den Bestimmungen dieses Beschlusses im Einklang standen. Ihrer Ansicht nach würden einige geringfügige Anpassungen ausreichen, um die vollständige Einhaltung des FRC-Beschlusses zu gewährleisten. Diese Mitgliedstaaten hatten ihren Risikomanagementrahmen vor allem dadurch angepasst, dass sie eine Bestandsaufnahme ihrer bereits bestehenden Profile vornahmen und diese anschließend mit den entsprechenden Kriterien für finanzielle Risiken verknüpften (nur ein Mitgliedstaat hatte eine Reihe von Risikoprofilen für Kriterien erstellt, die noch nicht durch seine bestehenden Profile abgedeckt waren). Der Hof stellte ferner fest, dass die Mitgliedstaaten bei der Zuordnung der Risikoprofile zu den im FRC-Beschluss festgelegten Kriterien nicht alle empfohlenen Indikatoren verwendeten. Folglich wenden die Mitgliedstaaten unterschiedliche Kriterien für die Auswahl von Zollanmeldungen zur Kontrolle an.
47Die vom Hof besuchten Mitgliedstaaten gingen nicht davon aus, dass sie ihre Kontrollkapazitäten infolge der Umsetzung des FRC-Beschlusses erhöhen würden. Der Risikomanagementansatz, den sie vor der Annahme des FRC-Beschlusses angewandt hatten, hatte sich nicht erheblich geändert, und sie gingen davon aus, dass er sich auch zukünftig nicht ändern würde. Kasten 4 enthält zwei Beispiele für die Anmerkungen dieser Länder zu den Auswirkungen der Einführung des FRC-Beschlusses und der Leitlinien auf ihre Risikomanagementsysteme.
Kasten 4
Ansichten der Mitgliedstaaten zu den Änderungen in ihren Managementsystemen für finanzielle Risiken im Zollbereich aufgrund der Umsetzung des FRC-Beschlusses
Ein vom Hof besuchter Mitgliedstaat war der Auffassung, dass sein System bereits vollständig mit dem FRC-Beschluss im Einklang stand. Seiner Ansicht nach liefern weder der Beschluss noch die Leitlinien substanzielle Beiträge zum Risikoanalyseverfahren, sondern schaffen dafür nur einen allgemeinen Rahmen. Mit dem FRC-Beschluss würden die bestehenden Methoden des Mitgliedstaats zur Analyse der finanziellen Risiken lediglich in ein Konzept gefasst.
Ein anderer Mitgliedstaat erklärte, dass es sich bei dem FRC-Beschluss um eine formalisierte Fortführung der bestehenden Tätigkeiten der Zollverwaltung im Finanzbereich handele.
In ihren Antworten auf den Fragebogen, der ihnen vor Annahme der Leitlinien übermittelt wurde, gaben 17 von 27 Mitgliedstaaten (63 %) an, die Umsetzung des FRC-Beschlusses werde nicht zu erheblichen Änderungen in ihren Risikomanagementsystemen führen. Die meisten der 10 Mitgliedstaaten, die davon ausgingen, erhebliche Änderungen vornehmen zu müssen, gaben an, ihre größte Herausforderung bestünde in der Aktualisierung ihrer IT-Systeme.
49Darüber hinaus wendeten die vom Hof besuchten Mitgliedstaaten nur für Kontrollen vor der Überlassung Risikoprofile an. Bei nachträglichen Kontrollen führten sie keine systematische Risikoanalyse anhand der Risikoprofile durch, die auf den Kriterien des FRC-Beschlusses beruhen (siehe Ziffer 25).
50Die Mitgliedstaaten wenden unterschiedliche Ansätze an, um die Zahl der Kontrollen auf ein Maß zu reduzieren, das bewältigt werden kann. In den vom Hof besuchten Mitgliedstaaten war die Steuerung der Auswirkungen in den Risikoprofilen für die Kontrollauswahl häufig ein Teil des automatisierten Risikoanalysesystems. Obwohl die Mitgliedstaaten die meisten oder die Gesamtheit der im FRC-Beschluss vorgeschriebenen Methoden anwendeten, gab es erhebliche Unterschiede, wie sie dies taten.
51Abbildung 7 zeigt für die vom Hof besuchten Mitgliedstaaten, welche Maßnahmen zur Steuerung der Auswirkungen auf Risikoprofile angewendet wurden, die die Unterbewertung einer bestimmten Warengruppe aus einem bestimmten Ursprungsland betreffen. Sie zeigt, dass dieselbe Einfuhranmeldung je nach Mitgliedstaat Gegenstand einer Kontrollempfehlung sein kann oder nicht. Bei einer Einfuhr von Erzeugnissen mit einem bestimmten Gewicht (deren Wert unter dem Schwellenwert der einzelnen Mitgliedstaaten liegt) würde beispielsweise wie folgt verfahren:
- Sie würde in Mitgliedstaat B nicht ausgewählt, da sie unterhalb des Schwellenwerts für das Gewicht liegt.
- Sie könnte in den Mitgliedstaaten A und D entweder ausgewählt werden oder nicht, da der Kontrollsatz je nach Differenz zwischen dem angemeldeten Wert und dem Schwellenwert sowie je nach Einführer variiert.
- Sie würde in den Mitgliedstaaten C und E ausgewählt, da das Gewicht bei der Steuerung der Auswirkungen nicht als Kriterium herangezogen wird. Die Wahrscheinlichkeit einer Außerachtlassung ist jedoch in diesen beiden Mitgliedstaaten viel höher als in den anderen drei Mitgliedstaaten.
Abbildung 7
In den Risikoprofilen für unterbewertete Erzeugnisse aus einem bestimmten Ursprungsland verwendete Maßnahmen zur Steuerung der Auswirkungen
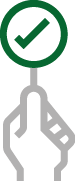 Ja Ja |
 Nein Nein |
||
| Mitgliedstaat | Bestimmte Wirtschafts-beteiligte ausgeschlossen (oder Kontrollsatz verringert) |
Schwellenwert für das Gewicht | Sonstige Verringerungen des Kontrollsatzes und Außerachtlassungen |
| A |  |
50 kg | Kontrollsätze beruhen auf anderen Risikoindikatoren. |
| B |  |
1 000 kg | n. z. |
| C |  |
 |
Hoher Anteil an Außerachtlassungen (über 50 %). |
| D |  |
 |
In bestimmten Fällen höhere Kontrollsätze. |
| E |  |
 |
Hoher Anteil an Außerachtlassungen (insgesamt 25 %). |
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von in den Mitgliedstaaten eingeholten Informationen.
Die Häufigkeit der Außerachtlassungen, die angegebenen Gründe sowie die Überwachung und Weiterverfolgung von Außerachtlassungen unterscheiden sich zwischen den besuchten Mitgliedstaaten erheblich. Die Zahl der außer Acht gelassenen Kontrollempfehlungen lag zwischen 1,6 % und 60 %. In Abbildung 8 ist dargestellt, wie diese Mitgliedstaaten Außerachtlassungen handhaben. Da Vorschriften oder Bedingungen für Außerachtlassungen fehlen, liegt die Entscheidung, ob die empfohlenen Kontrollen angewendet werden, vollständig im Ermessen der Mitgliedstaaten. Auch die Verfahren zur Begründung der Außerachtlassung sind in den Mitgliedstaaten unterschiedlich: In einigen Mitgliedstaaten ist eine Außerachtlassung nur möglich, wenn bestimmte im Voraus festgelegte Merkmale erfüllt sind, während andere Mitgliedstaaten Begründungen auf Einzelfallbasis liefern (siehe Ziffer 29).
Abbildung 8
Außerachtlassungen von Empfehlungen für Zollkontrollen in den besuchten Mitgliedstaaten
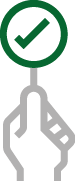 Ja Ja |
 Nein Nein |
 Genehmigung erforderlich,
nicht jedoch die Genehmigung einer vorgesetzten Stelle Genehmigung erforderlich,
nicht jedoch die Genehmigung einer vorgesetzten Stelle
|
|
| Mitgliedstaat | Erfüllung im Voraus festgelegter Merkmale erforderlich | Eingabe von Gründen in das System zwingend erforderlich | Genehmigung einer vorgesetzten Stelle zwingend erforderlich |
| A |  |
 |
 |
| B |  |
 |
 |
| C |  |
 |
 |
| D |  |
 |
 |
| E |  |
 |
 |
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von in den Mitgliedstaaten eingeholten Informationen.
Die Mitgliedstaaten ermitteln und bearbeiten Risikosignale auf unterschiedliche Weise
53Der Durchführungsrechtsakt zum Zollkodex der Union26 sieht vor, dass für die Kommunikation zwischen den Zollbehörden untereinander sowie zwischen den Zollbehörden und der Kommission bei der Umsetzung gemeinsamer Risikokriterien und ‑standards ein elektronisches System verwendet wird27. Die wichtigsten IT-Instrumente für das Risikomanagement auf EU-Ebene sind das Zollrisikomanagementsystem (CRMS) und das Informationssystem für die Betrugsbekämpfung (Anti-Fraud Information System, AFIS). Das CRMS ermöglicht den EU-weiten Austausch risikobezogener Informationen unter Verwendung von Online-Formularen, die als RIF bezeichnet werden. RIF können entweder von einem Mitgliedstaat oder von der Kommission (EU-RIF) übermittelt werden. Das AFIS ist das System, in das das OLAF „Amtshilfemitteilungen“ eingibt (Ersuchen an die Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, um Risiken entgegenzutreten, die bei Untersuchungen des OLAF ermittelt wurden). Diese Systeme enthalten Informationen über Risiken, die die Mitgliedstaaten in ihren nationalen Risikoanalysesystemen verwenden sollten.
54Die fünf vom Hof besuchten Mitgliedstaaten gaben an, dass sie die von Mitgliedstaaten übermittelten RIF nicht immer für hinreichend klar hielten, was bedeutet, dass sie ihnen die Erstellung eines Risikoprofils nicht erleichterten, und dass diese RIF in der Regel sowohl wiederholt als auch nur einmalig auftretende Risiken enthielten. Außerdem vertraten 21 Mitgliedstaaten (78 %) in ihren Antworten auf den Fragebogen des Hofes die Auffassung, dass „eine eingehendere Bearbeitung der Risikoinformationen auf EU-Ebene (z. B. eine erste Auswertung der Risiko-Informationsformulare der Mitgliedstaaten durch die Kommission) eine effizientere und stärker harmonisierte Risikoanalyse ermöglichen würde“.
55Die Mitgliedstaaten interpretieren Risikosignale in Amtshilfemitteilungen oder RIF auf unterschiedliche Weise. So unterscheiden sich beispielsweise die Risikoprofile, die als Reaktion auf Amtshilfemitteilungen zu gewissen unterbewerteten Erzeugnissen aus einem bestimmten Ursprungsland erstellt wurden, von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat erheblich. Es bestehen auch große Unterschiede zwischen den Risikoprofilen, die die einzelnen Mitgliedstaaten als Reaktion auf die EU-RIF erstellen, die nach Datenanalysen im Rahmen des JAC-Pilotprojekts der Kommission übermittelt wurden. Von den vom Hof besuchten Ländern ergriff nur ein Mitgliedstaat Maßnahmen, um die Kontrollen bei Einfuhren mit den in den EU-RIF genannten Codes und Ursprungsländern zu verringern.
56Der Rahmen enthält keine Vorschriften zur Harmonisierung der Zufallsauswahl (siehe Ziffer 35). In den besuchten Mitgliedstaaten traf der Hof auf unterschiedliche Ansätze (siehe Abbildung 9). Der prozentuale Anteil der Zufallsauswahl (d. h. der Anteil der anhand von Risikoprofilen nicht ausgewählten Anmeldungen, die anschließend nach dem Zufallsprinzip zur Kontrolle ausgewählt werden) ist von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat unterschiedlich (wobei diese Prozentsätze in den besuchten Mitgliedstaaten von 0,0067 % bis 0,5 % reichen). Die verschiedenen Ansätze haben zum Beispiel zur Folge, dass es für einen zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten in einem der besuchten Mitgliedstaaten 74-mal wahrscheinlicher ist, für Zufallskontrollen ausgewählt zu werden, als in einem der anderen Mitgliedstaaten. In zwei Mitgliedstaaten ist eine erhebliche Anzahl von Anmeldungen von der Zufallsauswahl ausgeschlossen, da vereinfachte Anmeldungen (siehe Ziffer 59) weder in die risikobasierte noch in die Zufallsauswahl einbezogen werden.
Abbildung 9
Prozentualer Anteil der Zufallsauswahl im Jahr 2019 in den besuchten Mitgliedstaaten
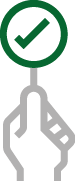 Ja Ja |
 Nein Nein |
|||
| Mitgliedstaat | Anmeldungen, auf die ein Prozentsatz angewendet wird | Weitere Einzelheiten | ||
| Standardanmeldungen | Vereinfachte Anmeldungen | Ergänzende Anmeldungen | ||
| A |  |
 |
 |
Unterschiedliche Prozentsätze je nach Art der Anmeldung |
| B |  |
 |
 |
Jede Zollstelle kann den Prozentsatz der Zufallsauswahl anpassen |
| C | Es erfolgt keine automatisierte Zufallsauswahl von Anmeldungen für Kontrollzwecke. | Die Zollstellen führen einige Zufallskontrollen durch | ||
| D |  |
 |
 |
Unterschiedliche Prozentsätze je nach Art der Kontrolle (Warenbeschau oder Prüfung von Unterlagen) |
| E |  |
 |
 |
|
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage von in den Mitgliedstaaten eingeholten Informationen.
Die Mitgliedstaaten tauschen Informationen über risikobehaftete Einführer nicht systematisch mit anderen Mitgliedstaaten aus
57Wie in Ziffer 36 dargelegt, ist die vorhandene Plattform nicht gut geeignet, um Informationen über risikobehaftete Einführer zwischen den Mitgliedstaaten auszutauschen. Der Hof stellte ferner fest, dass die besuchten Mitgliedstaaten im Rahmen ihres Risikomanagements nicht systematisch Informationen über diese risikobehafteten Einführer mit den anderen Mitgliedstaaten austauschten.
58Darüber hinaus verwenden die Mitgliedstaaten unterschiedliche Methoden zur Einstufung von Einführern als Wirtschaftsbeteiligte von Interesse, und auch die Art und Weise, wie sie diese Informationen in ihren Risikoprofilen verwenden, ist unterschiedlich. Einige Mitgliedstaaten verfügen über eine Liste mit Wirtschaftsbeteiligten von Interesse, die für mehrere Risikoprofile verwendet wird, um diese Händler verstärkt zu kontrollieren. Andere Mitgliedstaaten geben direkt in jedem Risikoprofil an, welche Händler mehr (oder weniger) Kontrollen unterliegen sollten. Auch die Definition und Ermittlung von Wirtschaftsbeteiligten von Interesse unterscheidet sich von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat. In einigen Mitgliedstaaten erfolgt die Bestimmung auf Einzelfallbasis, während andere ein automatisiertes Verfahren nutzen.
Nicht alle Mitgliedstaaten unterziehen alle (im Rahmen von Standardverfahren und vereinfachten Verfahren abgegebenen) Anmeldungen einer automatisierten Risikoanalyse
59Waren werden unter Verwendung einer Standardanmeldung gestellt, die alle rechtlich vorgeschriebenen Angaben enthält. Einige Einführer profitieren jedoch von einem System vereinfachter Anmeldungen, bei denen bestimmte Angaben oder Unterlagen nicht erforderlich sind und sie die Einfuhr mitunter lediglich in ihrer Buchführung erfassen können. In solchen Fällen muss der Einführer innerhalb einer bestimmten Frist eine ergänzende Zollanmeldung abgeben, die alle in einer Standardanmeldung erforderlichen Angaben enthält. Der Prozentsatz der vereinfachten Zollanmeldungen lag in den besuchten Mitgliedstaaten zwischen 25 % und 95 % der insgesamt eingereichten Anmeldungen.
60Zwei der besuchten Mitgliedstaaten unterziehen weder vereinfachte Anmeldungen noch die zugehörigen ergänzenden Anmeldungen einer automatisierten Risikoanalyse unter Verwendung der Risikoprofile, die auf dem FRC-Beschluss beruhen. Dies steht im Widerspruch zu den Anforderungen des FRC-Beschlusses und bedeutet, dass der Rahmen für die automatisierte Risikoanalyse eine erhebliche Anzahl von Einfuhren vollständig ausschließt. Die anderen drei besuchten Mitgliedstaaten verwenden zumindest für ergänzende Anmeldungen Risikoprofile. Abbildung 10 zeigt, wie die vom Hof besuchten Mitgliedstaaten eine automatisierte Risikoanalyse auf vereinfachte und ergänzende Anmeldungen anwenden.
Abbildung 10
Anwendung automatisierter Risikoanalysen auf vereinfachte und ergänzende Anmeldungen in den besuchten Mitgliedstaaten
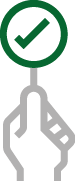 Ja Ja |
 Ja, aber mit Einschränkungen Ja, aber mit Einschränkungen |
 Nein Nein |
| Mitgliedstaat | Automatisierte Risikoanalyse … | |
| … wird auf vereinfachte Anmeldungen angewendet | … wird auf ergänzende Anmeldungen angewendet | |
| A |  |
 |
| B |  |
 |
| C |  |
 |
| D |  |
 |
| E |  |
 |
Quelle: Europäischer Rechnungshof auf der Grundlage der in den Mitgliedstaaten eingeholten Informationen.
In einem der besuchten Mitgliedstaaten konnte der Hof für ausgewählte Erzeugnisse sowohl die im Standardverfahren als auch die im vereinfachten Verfahren gemachten Angaben in den Einfuhranmeldungen analysieren. Das Beispiel in Kasten 5 zeigt, dass sich die erhobenen Zollbeträge in einigen Mitgliedstaaten verringern können, wenn vereinfachte Anmeldungen keiner automatisierten Risikoanalyse unterzogen werden.
Kasten 5
Risiko der Unterbewertung bei vereinfachten Anmeldungen
In einem der besuchten Mitgliedstaaten werden Standard-Zollanmeldungen und vereinfachte Zollanmeldungen in zwei getrennten IT-Systemen abgegeben. Der Hof analysierte die Einfuhren von vier Arten von in einem bestimmten Land erzeugten Waren, die im Zeitraum Juli bis August 2019 in diesen beiden Systemen erfasst wurden, und stellte fest, dass bei zwei dieser Waren der angemeldete Wert je Kilogramm eingeführter Waren bei vereinfachten Anmeldungen systematisch niedriger war als bei Standardanmeldungen. Bei vereinfachten Anmeldungen bildeten die Preise der eingeführten Waren Cluster (siehe nachstehende Illustration), die unter den geschätzten „fairen“ Preisen lagen (d. h. den Preisen, bei deren Unterschreitung das Risiko einer Unterbewertung besteht, und Anmeldungen zur Kontrolle ausgewählt werden sollten).
Die folgenden Schaubilder zeigen die auffällige Differenz bei der Verteilung des angegebenen Wertes/kg für eine Erzeugniskategorie je nach Art der Anmeldung. Würde in diesem Fall die Methode zur Ermittlung des Risikos einer Unterbewertung angewendet, müssten etwa zwei Drittel der vereinfachten Anmeldungen für eine Kontrolle ausgewählt werden. Da der Mitgliedstaat vereinfachte Anmeldungen jedoch keiner automatisierten Risikoanalyse unterwirft, wurden sie in seinem System nicht mit Warnhinweisen zwecks Kontrollen gekennzeichnet.

Anmerkung: Da Gewichtswerte aus dem IT-System für vereinfachte Anmeldungen auf das nächste Kilogramm gerundet werden, hat der Hof Anmeldungen unterhalb eines zuvor festgelegten Gewichts, die möglicherweise zu einem künstlichen Risiko der Unterbewertung geführt hätten, von dieser Analyse ausgenommen.
Schlussfolgerungen und Empfehlungen
62Im Zuge der Prüfung wurde analysiert, ob der von der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten entwickelte Risikomanagementrahmen (der auf dem FRC-Beschluss und den ergänzenden Leitlinien basiert) eine einheitliche Anwendung der Zollkontrollen zum Schutz der finanziellen Interessen der EU gewährleistet. Die Umsetzung des FRC-Beschlusses und der Leitlinien ist ein wichtiger Schritt hin zu einer einheitlichen Anwendung der Zollkontrollen. Der Hof gelangt jedoch zu dem Schluss, dass der Rahmen keine ausreichende Harmonisierung der Kontrollauswahl gewährleistet, um die finanziellen Interessen der EU zu schützen. Dies ist in erster Linie auf Schwachstellen in der Gestaltung des Rahmens zurückzuführen, die es den Mitgliedstaaten ermöglichen, ihn auf sehr unterschiedliche Art und Weise umzusetzen. Infolgedessen könnten Wirtschaftsbeteiligte, die die Vorschriften nicht einhalten, gezielt EU-Eingangszollstellen mit niedrigeren Kontrollniveaus nutzen.
63Einfuhren, die mit einem höheren Risiko für die finanziellen Interessen der EU verbunden sind, werden möglicherweise nicht ordnungsgemäß priorisiert (siehe Ziffer 21). Der FRC-Beschluss ist nicht detailliert genug, enthält nicht alle Anforderungen des UZK und räumt den Mitgliedstaaten einen zu großen Ermessensspielraum bei der Anwendung ein, auch in Bezug auf die Möglichkeiten zur Verringerung der Zahl der Kontrollen. Die Leitlinien sind nicht rechtsverbindlich und enthalten zu bestimmten Punkten keine klaren und präzisen Anweisungen (siehe Ziffern 22-29 und 35). Es gibt keine EU-weiten Plattformen oder Datenbanken zum systematischen Austausch von Informationen über alle risikobehafteten Einführer (siehe Ziffer 36). Der Rahmen umfasst keine geeigneten Instrumente zur Bewältigung der Risiken im elektronischen Handel (siehe Ziffer 37). Die bestehenden Vorkehrungen für die Überwachung und Überarbeitung sind nicht angemessen (siehe Ziffern 38-45). Die Risikosignale der EU sind nicht immer mit klaren Anweisungen verbunden, die die Mitgliedstaaten bei der Erstellung von Risikoprofilen verwenden müssen (siehe Ziffern 53-56). In einigen Mitgliedstaaten wird eine erhebliche Zahl von EU-Einfuhren keiner automatisierten Risikoanalyse unterzogen (siehe Ziffern 59-61).
Empfehlung 1 – Verbesserung der einheitlichen Anwendung von ZollkontrollenDie Kommission sollte die einheitliche Anwendung der Zollkontrollen verbessern, indem sie die folgenden Maßnahmen ergreift, welche die Unterstützung und gegebenenfalls die Zustimmung der Mitgliedstaaten erfordern:
- Verstärkung der Vorschriften für die Mitgliedstaaten, beispielsweise durch Aufnahme von Anweisungen und Einzelheiten in den Rahmen – auch zu Verfahren und Kriterien, die von den Mitgliedstaaten bei der Verringerung der Zahl der Kontrollen (einschließlich der Außerachtlassung von Kontrollempfehlungen) angewendet werden sollten, zur Anwendung des Rahmens auf nachträgliche Kontrollen und zur Anwendung der Zufallsauswahl – sowie durch Übertragung einiger der derzeit in den Leitlinien enthaltenen Vorschriften in den FRC-Beschluss;
- Aufnahme von Bestimmungen in den FRC-Beschluss und von Vorschriften in die Leitlinien, um sicherzustellen, dass die Risiken im Zusammenhang mit den Einfuhren im Rahmen des elektronischen Handels angemessen berücksichtigt werden;
- Verbesserung der Qualität der Risikosignale insbesondere dadurch, dass in den von den Mitgliedstaaten erstellten RIF mehr Klarheit und eine höhere Detailgenauigkeit verlangt wird, dass detaillierte Anweisungen für die Verwendung von EU-RIF und Amtshilfemitteilungen erteilt werden und dass die Umsetzung der RIF durch die Mitgliedstaaten weiterverfolgt und kontrolliert wird und von den Mitgliedstaaten eine obligatorische Rückmeldung verlangt wird;
- Bewertung, inwieweit sich die Risikoprofile der Mitgliedstaaten auf verschiedene Arten von Anmeldungen (Standard-Zollanmeldungen und vereinfachte Zollanmeldungen) erstrecken, und Sicherstellung, dass vorhandene Lücken in geeigneter Weise geschlossen werden;
- Entwicklung, Einrichtung und Pflege EU-weiter Risikodatenbanken, die von den Mitgliedstaaten genutzt werden können, z. B. Listen von Wirtschaftsbeteiligten von Interesse;
- Festlegung solider Regelungen für die Überwachung und Überarbeitung der Anwendung des Rahmens durch die Mitgliedstaaten.
Zeitrahmen: 2022
64Es gibt keine angemessene EU-weite Analyse der finanziellen Risiken im Zollbereich, die auf Daten aller EU-Einfuhren beruht (siehe Ziffern 30-34). Im derzeitigen Rahmen sind allgemeine Kriterien und Indikatoren festgelegt, die die Mitgliedstaaten bei ihrer Risikoanalyse anwenden müssen, wobei es ihnen überlassen bleibt, detaillierte Risikoprofile für die Auswahl von Einfuhren für Kontrollen zu erstellen. Der Rahmen bietet keinen integrierten Ansatz für das Management finanzieller Risiken auf EU-Ebene. Er hat die Verfahren der Mitgliedstaaten noch nicht in ausreichendem Maße verändert, um die finanziellen Interessen der EU angemessen zu schützen (siehe Ziffern 46-52).
Empfehlung 2 – Entwicklung und Umsetzung einer umfassenden Analyse- und Koordinierungskapazität auf EU-EbeneDie Kommission sollte eine zentrale Stelle auf EU-Ebene schaffen, um die Anstrengungen im Bereich der Zollkontrollen insgesamt besser zu steuern. Dabei sollten die Fachkenntnisse der Kommission und der Mitgliedstaaten zusammengeführt werden, um die wichtigsten finanziellen Risiken im Zollwesen zu analysieren und um zu ermitteln, wie sie am besten angegangen werden können.
Die Kommission sollte analysieren, wie dies auf wirksame und tragfähige Weise erreicht werden kann. Zu den möglichen Szenarien könnte u. a. Folgendes gehören: Erweiterung der Zuständigkeiten der bestehenden Zollarbeitsgruppen, Einrichtung einer spezifischen Dienststelle innerhalb einer GD (oder einer übergreifenden Dienststelle der GD TAXUD, der GD BUDG und des OLAF) oder Aufbau einer speziellen EU-Agentur.
Die zentrale Stelle sollte
- beispielsweise unter dem Gesichtspunkt der Wesentlichkeit festlegen, welche Risiken einem integrierten Ansatz unterliegen sollten (EU-relevante Risiken), und in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten sicherstellen, dass diesen Risiken angemessen begegnet wird;
- wirksame Data-Mining-Kapazitäten entwickeln und umsetzen, um Datenanalysen auf EU-Ebene durchzuführen und EU-relevante Risiken zu ermitteln;
- Möglichkeiten zur Entwicklung von IT-Risikomanagementinstrumenten ausloten, die mit den Einfuhr- und Risikomanagementsystemen der Mitgliedstaaten kompatibel sind, um bei EU-relevanten Risiken die direkte und automatische Anwendung von Kontrollempfehlungen zu ermöglichen.
Zeitrahmen: 2023
Dieser Bericht wurde von Kammer V unter Vorsitz von Herrn Tony Murphy, Mitglied des Rechnungshofs, am 23. Februar 2021 in Luxemburg angenommen.
Für den Rechnungshof

Klaus-Heiner Lehne
Präsident
Akronyme und Abkürzungen
AEUV: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union
AFIS: Anti-Fraud Information System (Informationssystem für die Betrugsbekämpfung)
BNE: Bruttonationaleinkommen
Comext: Eurostats Datenbank zur Außenhandelsstatistik
CRMS: Customs Risk Management System (Zollrisikomanagementsystem)
CUP: Customs Union Performance (Leistungsbewertung der Zollunion)
EU: Europäische Union
FRC-Beschluss: Financial Risks Criteria and Standards Implementing Decision (Durchführungsbeschluss über Kriterien und Standards für finanzielle Risiken)
GD TAXUD: Generaldirektion Steuern und Zollunion
GD BUDG: Generaldirektion Haushalt
ISO: International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung)
IT: Informationstechnologie
JAC: Joint Analysis Capacity (Pilotprojekt für gemeinsame Analysen)
MwSt.: Mehrwertsteuer
OLAF: Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung
RIF: Risk Information Form (Risiko-Informationsformular)
TEM: Traditionelle Eigenmittel
UZK: Zollkodex der Union
WZO: Weltzollorganisation
Glossar
Risikomanagement: systematische Ermittlung von Risiken und Umsetzung von Maßnahmen zu ihrer Minderung bzw. Beseitigung oder zur Verringerung ihrer Auswirkungen.
Risikoprofil: Kombination von Risikokriterien, die zur Ermittlung von mit einem höheren Risiko verbundenen Zollanmeldungen beitragen, bei denen die Durchführung von Zollkontrollen in Erwägung gezogen werden sollte.
Risikosignal: Information über ein potenzielles Risiko, die zur Erstellung von Risikoprofilen verwendet werden kann.
Zollanmeldung: offizielles Dokument mit Einzelheiten zu den Waren, die zur Einfuhr, Ausfuhr oder im Rahmen eines anderen Zollverfahrens gestellt werden.
Zollkontrollen: Verfahren zur Überprüfung der Einhaltung der EU-Zollvorschriften und anderer einschlägiger Rechtsvorschriften.
Zolllücke: Differenz zwischen den für die Wirtschaft insgesamt zu erwartenden Einfuhrabgaben und dem tatsächlich erhobenen Betrag.
Zollunion: Ergebnis einer Vereinbarung zwischen einer Gruppe von Ländern, frei miteinander zu handeln und gleichzeitig einen gemeinsamen Zolltarif auf Einfuhren aus anderen Ländern zu erheben.
Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter: Person oder Unternehmen, die/das als zuverlässig gilt und der/dem daher im Zusammenhang mit Zollvorgängen Vorteile gewährt werden.
Prüfungsteam
Die Sonderberichte des Hofes enthalten die Ergebnisse seiner Prüfungen zu Politikbereichen und Programmen der Europäischen Union oder zu Fragen des Finanzmanagements in spezifischen Haushaltsbereichen. Bei der Auswahl und Gestaltung dieser Prüfungsaufgaben ist der Hof darauf bedacht, maximale Wirkung dadurch zu erzielen, dass er die Risiken für die Wirtschaftlichkeit oder Regelkonformität, die Höhe der betreffenden Einnahmen oder Ausgaben, künftige Entwicklungen sowie das politische und öffentliche Interesse abwägt.
Diese Wirtschaftlichkeitsprüfung wurde von Prüfungskammer V „Finanzierung und Verwaltung der Union“ unter Vorsitz von Tony Murphy, Mitglied des Hofes, durchgeführt. Die Prüfung stand unter der Leitung von Jan Gregor, Mitglied des Hofes. Herr Gregor wurde unterstützt von seinem Kabinettchef Werner Vlasselaer, dem Attaché Bernard Moya, dem Leitenden Manager Alberto Gasperoni, dem Aufgabenleiter José Parente, der Prüferin Diana Voinea und dem Prüfer Csaba Hatvani. Michael Pyper leistete sprachliche Unterstützung.

Endnoten
1 Artikel 3 der konsolidierten Fassung des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) (ABl. C 202 vom 7.6.2016, S. 47).
2 Artikel 291 AEUV.
3 Quelle: Eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=International_trade_in_goods/de.
4 Siehe Ziffern 29-32 des Sonderberichts Nr. 19/2017, „Einfuhrverfahren: Schwachstellen im Rechtsrahmen und eine unwirksame Umsetzung wirken sich auf die finanziellen Interessen der EU aus“.
5 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (Neufassung) (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1) (UZK-Verordnung).
6 Artikel 5 Absatz 7.
7 WCO Customs Risk Management Compendium, S. 15.
8 Verordnung (EWG) Nr. 2913/92 des Rates vom 12. Oktober 1992 zur Festlegung des Zollkodex der Gemeinschaften (ABl. L 302 vom 19.10.1992, S. 1).
9 Siehe Ziffer 4.20 bzw. Ziffer 4.15 der Jahresberichte des Hofes zu den Haushaltsjahren 2014 und 2015.
10 Siehe Ziffer 113 des Sonderberichts Nr. 23/2016, „Seeverkehr in der EU: in schwierigem Fahrwasser – zahlreiche nicht wirksame und nicht nachhaltige Investitionen“.
11 Siehe Ziffer 148 des Sonderberichts Nr. 19/2017, „Einfuhrverfahren: Schwachstellen im Rechtsrahmen und eine unwirksame Umsetzung wirken sich auf die finanziellen Interessen der EU aus“.
12 Siehe die folgende Studie: Europäisches Parlament, Generaldirektion Interne Politikbereiche, „Von der Schattenwirtschaft zur amtlich erfassten Wirtschaft: Angleichung der Wettbewerbsbedingungen im Binnenmarkt“, 2013.
13 Siehe Sonderbericht Nr. 19/2017, „Einfuhrverfahren: Schwachstellen im Rechtsrahmen und eine unwirksame Umsetzung wirken sich auf die finanziellen Interessen der EU aus“.
14 Durchführungsbeschluss der Kommission vom 31.5.2018 mit Maßnahmen zur einheitlichen Anwendung von Zollkontrollen für zur Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr angemeldete Waren durch Festlegung gemeinsamer Kriterien und Standards für finanzielle Risiken gemäß der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union.
15 Siehe den „Bericht der Kommission an den Rat und das Europäische Parlament über die Fortschritte bei der Umsetzung der Strategie und des Aktionsplans der EU für das Zollrisikomanagement“ vom 20. Juli 2018.
16 Politische Leitlinien für die künftige Europäische Kommission 2019-2024.
17 Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament, den Rat und den Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss, „Aktionsplan für den Ausbau der Zollunion“, COM(2020) 581 final vom 28.9.2020.
18 WCO Customs Risk Management Compendium.
19 Artikel 46 Absatz 7.
20 Anhang 4 zu Band 1 des Zollrisikomanagementkompendiums der WZO.
21 ISO 31000: 2018 Risikomanagement – Leitlinien, S. 3.
22 Siehe Jahresbericht des Hofes zum Haushaltsjahr 2017, Ziffer 4.23, Empfehlung 1.
23 Siehe das Risikomanagementkompendium der WZO und Artikel 5 Absatz 25 UZK.
24 Der Hof hat vor Kurzem einen Bericht über die Herausforderungen im Bereich des elektronischen Handels veröffentlicht: Sonderbericht Nr. 12/2019, „Elektronischer Handel: Zahlreiche Herausforderungen bei der Erhebung von MwSt. und Zöllen müssen noch angegangen werden“.
25 Bericht Nr. 7/2017, „Rigsrevisionens beretning om SKATs kontrol og vejledning på toldområdet“ (Bericht des dänischen Rechnungshofs über die Kontrolle und die Leitlinien der Steuerbehörde im Zollbereich), Dezember 2017.
26 Durchführungsverordnung (EU) 2015/2447 der Kommission vom 24. November 2015 mit Einzelheiten zur Umsetzung von Bestimmungen der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 343 vom 29.12.2015, S. 558-893).
27 Ebenda, Artikel 36.
Zeitschiene
| Verfahrensschritt | Datum |
|---|---|
| Annahme des Prüfungsplans/Beginn der Prüfung | 24.9.2019 |
| Offizielle Übermittlung des Berichtsentwurfs an die Kommission (bzw. die sonstigen geprüften Stellen) | 23.12.2020 |
| Annahme des endgültigen Berichts nach Abschluss des kontradiktorischen Verfahrens | 23.2.2021 |
| Eingang der offiziellen Antworten der Kommission (bzw. der sonstigen geprüften Stellen) in allen Sprachfassungen | 15.3.2021 |
Kontakt
EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF
12, rue Alcide De Gasperi
1615 Luxemburg
LUXEMBURG
Tel. +352 4398-1
Kontaktformular: eca.europa.eu/de/Pages/ContactForm.aspx
Website: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors
Zahlreiche weitere Informationen zur Europäischen Union sind verfügbar über Internet, Server Europa (http://europa.eu).
Luxemburg: Amt für Veröffentlichungen der Europäischen Union, 2021
| ISBN 978-92-847-5793-0 | ISSN 1977-5644 | doi:10.2865/660905 | QJ-AB-21-005-DE-N | |
| HTML | ISBN 978-92-847-5774-9 | ISSN 1977-5644 | doi:10.2865/254 | QJ-AB-21-005-DE-Q |
URHEBERRECHTSHINWEIS
© Europäische Union, 2021
Die Weiterverwendung von Dokumenten des Europäischen Rechnungshofs wird durch den Beschluss Nr. 6-2019 des Europäischen Rechnungshofs über die Politik des offenen Datenzugangs und die Weiterverwendung von Dokumenten geregelt.
Sofern nicht anders angegeben (z. B. in gesonderten Urheberrechtshinweisen), werden die Inhalte des Hofes, die Eigentum der EU sind, im Rahmen der Lizenz „Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)“ zur Verfügung gestellt. Das bedeutet, dass eine Weiterverwendung gestattet ist, sofern die Quelle in angemessener Weise angegeben und auf Änderungen hingewiesen wird. Der Weiterverwender darf die ursprüngliche Bedeutung oder Botschaft der Dokumente nicht verzerrt darstellen. Der Hof haftet nicht für etwaige Folgen der Weiterverwendung.
Sie sind zur Einholung zusätzlicher Rechte verpflichtet, falls ein bestimmter Inhalt identifizierbare Privatpersonen zeigt, z. B. auf Fotos von Mitarbeitern des Hofes, oder Werke Dritter enthält. Wird eine Genehmigung eingeholt, so hebt diese die vorstehende allgemeine Genehmigung auf; auf etwaige Nutzungsbeschränkungen wird ausdrücklich hingewiesen.
Wollen Sie Inhalte verwenden oder wiedergeben, an denen die EU keine Urheberrechte hat, müssen Sie eine Genehmigung direkt bei den Urheberrechtsinhabern einholen.
Software oder Dokumente, die von gewerblichen Schutzrechten erfasst werden, wie Patente, Marken, eingetragene Muster, Logos und Namen, sind von der Weiterverwendungspolitik des Hofes ausgenommen und werden Ihnen nicht im Rahmen der Lizenz zur Verfügung gestellt.
Die Websites der Organe der Europäischen Union in der Domain „europa.eu“ enthalten mitunter Links zu von Dritten betriebenen Websites. Da der Hof diesbezüglich keinerlei Kontrolle hat, sollten Sie deren Bestimmungen zum Datenschutz und zum Urheberrecht einsehen.
Verwendung des Logos des Europäischen Rechnungshofs
Das Logo des Europäischen Rechnungshofs darf nur mit vorheriger Genehmigung des Europäischen Rechnungshofs verwendet werden.
DIE EU KONTAKTIEREN
Besuch
In der Europäischen Union gibt es Hunderte von „Europe-Direct“-Informationsbüros. Über diesen Link finden Sie ein Informationsbüro in Ihrer Nähe: https://europa.eu/european-union/contact_de
Telefon oder E-Mail
Der Europe-Direct-Dienst beantwortet Ihre Fragen zur Europäischen Union. Kontaktieren Sie Europe Direct
- über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche Telefondienstanbieter berechnen allerdings Gebühren),
- über die Standardrufnummer: +32 22999696 oder
- per E-Mail über: https://europa.eu/european-union/contact_de
INFORMATIONEN ÜBER DIE EU
Im Internet
Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die Europäische Union in allen Amtssprachen: https://europa.eu/european-union/index_de
EU-Veröffentlichungen
Sie können – zum Teil kostenlos – EU-Veröffentlichungen herunterladen oder bestellen unter https://op.europa.eu/de/publications. Wünschen Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen Veröffentlichung, wenden Sie sich an Europe Direct oder das Informationsbüro in Ihrer Nähe (siehe https://europa.eu/european-union/contact_de).
Informationen zum EU-Recht
Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1952 in sämtlichen Amtssprachen, finden Sie in EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu
Offene Daten der EU
Über ihr Offenes Datenportal (http://data.europa.eu/euodp/de) stellt die EU Datensätze zur Verfügung. Die Daten können zu gewerblichen und nichtgewerblichen Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden.
 Sonderbericht
Sonderbericht