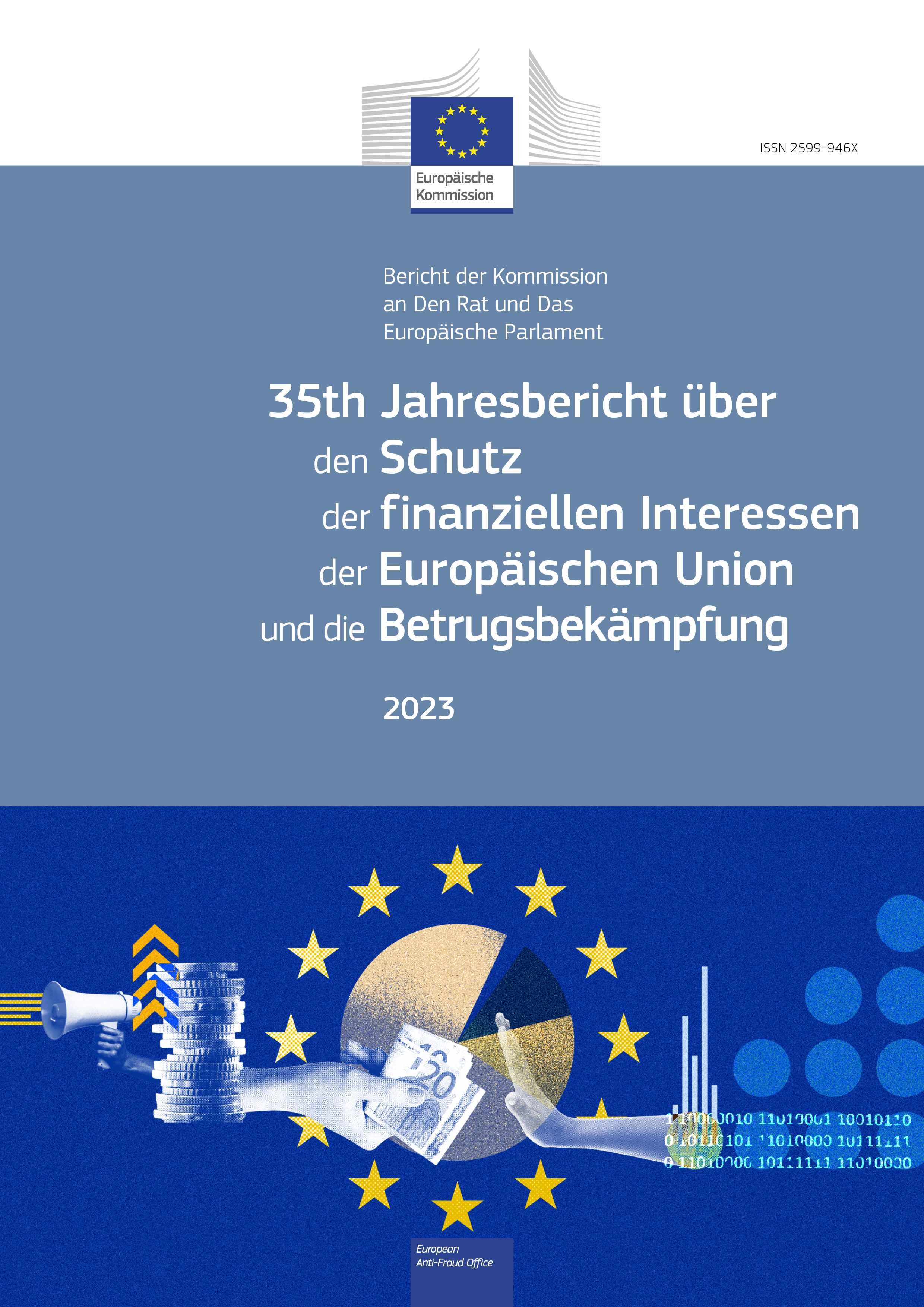

ZUSAMMENFASSUNG
Im Einklang mit der Verpflichtung gemäß Artikel 325 Absatz 5 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) legt die Europäische Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat jedes Jahr in Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten einen Bericht (den Bericht über den Schutz der finanziellen Interessen/PIF-Bericht) über die zur Durchführung des Artikels ergriffenen Maßnahmen vor. Auf der Grundlage dieses Berichts nimmt das Europäische Parlament seinen jährlichen Entschließungsantrag zum Schutz der finanziellen Interessen der EU und zur Betrugsbekämpfung an.
Im PIF-Bericht 2023 wird intensiv auf Maßnahmen auf EU- und nationaler Ebene zur Stärkung des Schutzes der finanziellen Interessen der EU eingegangen.
Bis Ende 2023 wurde eine politische Einigung über die vorgeschlagene Neufassung der Haushaltsordnung zur Stärkung des Schutzes der finanziellen Interessen der EU erzielt. Mit dem vereinbarten Text wird der Anwendungsbereich des Früherkennungs- und Ausschlusssystems auf die geteilte Mittelverwaltung ausgeweitet. Außerdem wird die Rechtsgrundlage für ein modernisiertes Tool zur Datenauswertung und Risikobeurteilung geschaffen, das auf dem bestehenden Arachne-Tool aufbaut.
Da die Ausgaben im Zusammenhang mit der Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne , verstärkt die Kommission ihre Prüfungstätigkeiten in Bezug auf die Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Ausgaben und den Schutz der finanziellen Interessen der EU. Die Überarbeitung der nationalen Pläne bot auch Gelegenheit, die Angemessenheit und Robustheit der Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten neu zu bewerten und erforderlichenfalls zusätzliche Anforderungen aufzunehmen.
Die Kommission hat ein Paket von Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung, einschließlich eines Vorschlags für eine Richtlinie zur Korruptionsbekämpfung, verabschiedet. Der ehrgeizige Vorschlag zielt darauf ab, die Korruptionsprävention in allen Mitgliedstaaten zu verstärken, Korruptionsdelikte und -sanktionen zu harmonisieren und sicherzustellen, dass die Strafverfolgungs- und Anklagebehörden über die Instrumente verfügen, die sie zur Bekämpfung von Korruption benötigen.
Da der Aktionsplan der Kommission zur Betrugsbekämpfungsstrategie von 2019 vollständig umgesetzt wurde, nahm die Kommission 2023 einen neuen Aktionsplan mit sieben Schwerpunktthemen an, darunter die Digitalisierung der Betrugsbekämpfung.
Das Betrugsbekämpfungsprogramm der EU hat das dritte Jahr seiner Umsetzung abgeschlossen. Es finanziert EU-weite Initiativen zur Intensivierung der Betrugsbekämpfung und unterstützt die Pflege und Entwicklung von IT-Tools. Diese dienen der Amtshilfe für den Zoll und unterstützen die Meldung von Unregelmäßigkeiten.
Im Jahr 2023 gaben 21 von 27 Mitgliedstaaten an, dass sie über eine Betrugsbekämpfungsstrategie zum Schutz der finanziellen Interessen der EU verfügten. Der Ansatz der 21 Mitgliedstaaten war sehr unterschiedlich: 10 Länder nahmen eine nationale Betrugsbekämpfungsstrategie an, während die anderen auf andere Arten von Strategien (sektoral, regional, programmbezogen) zurückgriffen.
Die Mitgliedstaaten folgen auch den Empfehlungen der Kommission, ihre Betrugsbekämpfungspolitik zu stärken und die Digitalisierung der Betrugsbekämpfung ganz oben auf ihre Tagesordnung zu setzen. Diesem zentralen Aspekt der Betrugsbekämpfung wird auch durch die zunehmende Zahl der auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen Rechnung getragen.
Die Schlüsselindikatoren für aufgedeckte Betrugsfälle und Unregelmäßigkeiten entsprechen denen der Vorjahre, ebenso wie die wichtigsten festgestellten Probleme, z. B. im Zusammenhang mit der Weiterverfolgung von Betrugsverdachtsfällen. Die Kommission bekräftigt daher die im PIF-Bericht 2022 ausgesprochenen Empfehlungen. Dies wird auch eine kontinuierliche Überwachung der Maßnahmen gewährleisten, die im Zusammenhang mit der Stärkung der Governance im Bereich der Betrugsbekämpfung, der Digitalisierung der Betrugsbekämpfung und der Verbesserungen im Zusammenhang mit der Aufdeckung, Meldung und Weiterverfolgung von Betrugsverdachtsfällen ergriffen wurden.
1. Einleitung
1.1. Die finanziellen Interessen der EU und ihr Schutz
Der Haushaltsplan der EU für 2023 belief sich auf etwa 186,6 Mrd. EUR an Mitteln für Verpflichtungen und 168,6 Mrd. EUR an Mitteln für Zahlungen. Dies entspricht einem Anstieg der Mittel für Verpflichtungen um 1,1 % und der Mittel für Zahlungen um 1 % gegenüber dem Haushaltsplan 2022. Der mehrjährige Finanzrahmen 2021-2027 beläuft sich auf 1 074,3 Mrd. EUR. Zusätzliche Mittel stammen aus NextGeneration EU, dem Konjunkturpaket der EU für die Zeit nach der COVID-19-Krise. Darin sind 750 Mrd. EUR vorgesehen, die zwischen 2021 und 2026 ausgegeben werden sollen.
Mit diesen Mitteln finanziert die EU ihre Politik und fördert ihre Ziele und Werte.
Die EU-Mitgliedstaaten verwalten den größten Teil der EU-Ausgaben und ziehen die Mehrwertsteuer und die traditionellen Eigenmittel (TEM, hauptsächlich Zölle) ein.
Gemäß Artikel 325 AEUV müssen die EU und ihre Mitgliedstaaten Betrügereien und sonstige rechtswidrige Handlungen zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU bekämpfen.1 Gemäß Artikel 325 Absatz 5 AEUV legt die Kommission in Zusammenarbeit mit den EU-Mitgliedstaaten dem Europäischen Parlament und dem Rat jährlich einen Bericht über die Maßnahmen vor, die zur Durchführung dieses Artikels getroffen wurden. Der vorliegende Bericht, auch bekannt als PIF-Bericht (Bericht über den Schutz der finanziellen Interessen der EU) kommt dieser Verpflichtung für 2023 nach. Dem Bericht sind sieben Arbeitsunterlagen beigefügt.2
Abschnitt 2 des Berichts befasst sich vorwiegend mit Maßnahmen auf EU-Ebene, während Abschnitt 3 die auf nationaler Ebene ergriffenen Maßnahmen behandelt. Abschnitt 4 enthält Daten und die wichtigsten analytischen Erkenntnisse zur Bekämpfung von Betrug, Korruption, Interessenkonflikten und anderen Unregelmäßigkeiten, die sich auf den EU-Haushalt auswirken. Abschnitt 5 enthält Schlussfolgerungen und Empfehlungen.
1.2. Datenquellen
Abschnitt 3 dieses Berichts stützt sich auf Informationen, die von den Mitgliedstaaten im Rahmen spezieller Fragebögen bereitgestellt werden. Abschnitt 4 basiert auf Unregelmäßigkeiten, die von den Mitgliedstaaten3 (Abschnitte 4.2 und 4.3) und den begünstigten Ländern der Heranführungshilfe4 (Abschnitt 4.4) aufgedeckt und gemeldet wurden, und auf Einziehungsanordnungen aus dem Rechnungsführungssystem der Kommission ABAC (direkte Mittelverwaltung, Abschnitt 4.4).
In den sektorspezifischen Vorschriften über traditionelle Eigenmittel, Mittel mit geteilter Mittelverwaltung und Heranführungsinstrumente sind die Bedingungen festgelegt, unter denen die Mitgliedstaaten und die begünstigten Länder der Heranführungshilfe die in diesen Bereichen aufgedeckten Unregelmäßigkeiten melden müssen. Die Meldung von Unregelmäßigkeiten unterliegt gewissen Einschränkungen.5
In diesem Bericht werden für die von den Mitgliedstaaten und den begünstigten Ländern gemeldeten Fälle zwei Hauptkategorien verwendet: betrügerische Unregelmäßigkeiten6 und nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten.7
In Abschnitt 4.1.1 werden die wichtigsten administrativen Ermittlungsergebnisse des Europäischen Amtes für Betrugsbekämpfung im Jahr 2023 zusammengefasst, die seinem Jahresbericht entnommen wurden. Der OLAF-Jahresbericht 20238 bezieht sich insbesondere auf alle im Berichtsjahr abgeschlossenen Untersuchungen.
In Abschnitt 4.1.2 werden die wichtigsten gerichtlichen Ermittlungsergebnisse der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA) im Jahr 2023 zusammengefasst, die ihrem Jahresbericht entnommen wurden. Der Jahresbericht 2023 der EUStA9 enthält unter anderem Statistiken über die im Berichtsjahr eingeleiteten Ermittlungen10 sowie über alle am Ende des Berichtsjahrs laufenden Ermittlungen11 .
Die Datenquellen weisen erhebliche Unterschiede in Bezug auf Art, Umfang, abgedeckte Haushaltsbereiche und Fristen auf.12
Der PIF-Bericht verfolgt in erster Linie einen einjährigen Ansatz und stellt die im Berichtsjahr gemeldeten Unregelmäßigkeiten dar. Er zeigt die von den Mitgliedstaaten berechneten und gemeldeten Beträge als finanzielle Auswirkungen der aufgedeckten Unregelmäßigkeiten auf.13
In der folgenden Tabelle sind die wichtigsten Unterschiede zwischen den drei Hauptdatenquellen zusammengefasst.
Abbildung 1: Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen den in diesem Bericht verwendeten Datenquellen
| PIF-Bericht | OLAF-Bericht | EUStA-Bericht | |
|---|---|---|---|
| Anwendungsbereich | |||
| Spezifisch für die Tätigkeiten einer einzigen Stelle | Nein | Ja | Ja |
| Betrügerische Unregelmäßigkeiten | Ja | Ja(a) | Ja |
| Nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten | Ja | Ja | Nein |
| Räumlicher Anwendungsbereich | |||
| An der Europäischen Verteidigungsagentur (EPPO) beteiligte Mitgliedstaaten | Ja | Ja | Ja |
| Nicht an der EPPO teilnehmende Mitgliedstaaten | Ja | Ja | Ja(a) |
| Länder außerhalb der EU | Ja(b) | Ja | Ja(a) |
| Haushaltsbereich | |||
| Geteilte Mittelverwaltung | Ja | Ja | Ja |
| Zollbetrug (ohne MwSt) | Ja | Ja | Ja |
| Indirekte Mittelverwaltung (Heranführungshilfe) | Ja | Ja | Ja(a) |
| Direkte Mittelverwaltung (nicht ARF) | Ja | Ja | Ja |
| Direkte Mittelverwaltung (ARF) | Nein | Ja | Ja |
| MwSt-Betrug | Nein | Ja | Ja |
| Datenquellen | |||
| Direkt(c) | Teilweise verfügbar | Ja | Ja |
| Indirekt(d) | Ja | Nein | Nein |
| Zeitrahmen | |||
| Einjährig(e) | Ja | Ja | Teilweise |
| Aggregiert(f) | Teilweise | Teilweise | Ja |
(a)Innerhalb der Grenzen seines/ihres Mandats.
(b)Beschränkt auf Länder, die Heranführungshilfe erhalten.
(c)Direkte Datenquelle bedeutet, dass sich der Bericht auf Fälle bezieht, die von der Meldestelle direkt untersucht werden. Die Daten zu den von der Kommission aufgedeckten Fällen stellen nur einen begrenzten Teil des im PIF-Bericht verwendeten Datensatzes dar.
(d)Indirekte Datenquelle bedeutet, dass die gemeldeten Daten aus einer anderen Datenquelle stammen. Im Falle des PIF-Berichts verwendet die Kommission Daten über (betrügerische und nicht betrügerische) Unregelmäßigkeiten, die von den nationalen Behörden der Mitgliedstaaten und der Bewerberländer gemeldet wurden.
(e)Der Bericht der EUStA enthält Informationen zu den im Berichtsjahr herangezogenen Daten (eingeleitete Ermittlungen, erlassene Sicherstellungsentscheidungen) sowie aggregierte Daten (aktive Ermittlungen).
(f)Aggregierte Daten (in der Regel für die letzten fünf Jahre) für den PIF-Bericht sind in der Arbeitsunterlage der Kommissionsdienststellen „Statistische Evaluierung der gemeldeten Unregelmäßigkeiten“ verfügbar, nicht aber im Bericht selbst. – Der OLAF-Bericht enthält aggregierte Daten zu einigen Arten von Informationen, die sich hauptsächlich auf die letzten fünf Jahre beziehen. – Der EUStA-Bericht enthält aggregierte Daten in Bezug auf aktive Ermittlungen.
2. Wichtige Maßnahmen auf EU-Ebene
In diesem Abschnitt werden die wesentlichen Entwicklungen bei wichtigen politischen und legislativen Initiativen auf EU-Ebene zum Schutz der finanziellen Interessen der EU behandelt. Es handelt sich nicht um eine erschöpfende Aufzählung.
2.1. Neufassung der Haushaltsordnung
Der Schutz der finanziellen Interessen der EU wurde durch die politische Einigung über die Neufassung der Haushaltsordnung vom 7. Dezember 2023 gestärkt. Die am Früherkennungs- und Ausschlusssystem (Early Detection and Exclusion System, EDES) vorgenommenen Änderungen und die Einführung der Rechtsgrundlage für ein Tool zur Risikobeurteilung und Datenauswertung sowie Änderungen am Transparenzsystem haben das Ziel der Aufdeckung und Prävention von Betrug und die Verbesserung der Schutzmaßnahmen gegen Betrug und der Betrugsbekämpfung.
Erstens einigten sich die beiden gesetzgebenden Organe in Bezug auf das EDES darauf, dessen Anwendungsbereich für die schwerwiegendsten Straftaten (z. B. Betrug, Korruption, Geldwäsche) auf Fonds mit geteilter Mittelverwaltung und im Rahmen der direkten Mittelverwaltung von den Mitgliedstaaten ausgezahlte Mittel auszuweiten. Die Änderung gilt für Programme, die ab dem 1. Januar 2028 angenommen oder finanziert werden. Darüber hinaus bringt die neue Haushaltsordnung weitere Verbesserungen für das System, darunter i) die Möglichkeit, wirtschaftliche Eigentümer und verbundene Stellen einer primär ausgeschlossenen Stelle auszuschließen, ii) neue Ausschlussgründe (z. B. Verweigerung der Zusammenarbeit bei Untersuchungen, Kontrollen oder Prüfungen, die von EU-Untersuchungsstellen durchgeführt werden), iii) Einführung eines beschleunigten Verfahrens vor dem EDES-Gremium.
Mit der Neufassung der Haushaltsordnung wurde auch die Rechtsgrundlage für ein modernisiertes Tool zur Datenauswertung und Risikobeurteilung geschaffen, das auf dem bestehenden Arachne-Tool aufbaut. Das derzeitige Tool wird von der Kommission und einer Reihe von Mitgliedstaaten freiwillig im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung und für die Aufbau- und Resilienzfazilität (ARF) eingesetzt. Das modernisierte Tool zur Datenauswertung und Risikobeurteilung soll bei allen Arten der Mittelverwaltung eingesetzt werden. Alle Mitgliedstaaten müssen ab dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen Daten in das Tool einspeisen. Die Kommission muss die Bereitschaft des überarbeiteten Tools bis 2027 in Bezug auf die Interoperabilität mit anderen IT-Systemen und Datenbanken (Vermeidung von Doppelmeldungen), die auf die Bedürfnisse der Nutzer ausgerichteten Risikoindikatoren, KI für die Analyse und Interpretation von Daten und Datenschutz bewerten. Auf dieser Grundlage kann die Möglichkeit der obligatorischen Verwendung von den gesetzgebenden Organen erneut erörtert werden.
Um den Verwaltungsaufwand für die Mitgliedstaaten und alle Einrichtungen, die den EU-Haushalt ausführen, zu verringern, wurde mit der Haushaltsordnung auch ein Element der Interoperabilität eingeführt und die Datenkategorien, die aus dem Tool zur Datenauswertung und Risikobeurteilung in das Finanztransparenzsystem der Kommission extrahiert werden sollen, wurden harmonisiert.
2.2. Umsetzung der nationalen Aufbau- und Resilienzpläne
Im Jahr 2023 war neben der Umsetzung der ARF die Überarbeitung der 27 nationalen Aufbau- und Resilienzpläne (ARP) eine weitere Priorität der Kommission, um den veränderten Umständen infolge der durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine verursachten Störungen des Energiemarkts Rechnung zu tragen. Mit der Aufnahme der REPowerEU-Kapitel in die ARP will die EU ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen aus Russland rasch verringern, indem sie die Energiewende beschleunigt.
Im Jahr 2023 tätigte die Kommission 22 Zahlungen an die Mitgliedstaaten in Höhe von insgesamt 74,4 Mrd. EUR (28,7 Mrd. EUR an Darlehen). Damit belaufen sich die Auszahlungen bis Ende 2023 auf insgesamt 220,5 Mrd. EUR, aufgeteilt in 141,6 Mrd. EUR in Form von Finanzhilfen (40 % der Gesamtmittelausstattung der ARF in Höhe von 357 Mrd. EUR) und 78,9 Mrd. EUR in Darlehen (27 % der Gesamtfinanzausstattung der ARF in Höhe von 291 Mrd. EUR).
Seit Beginn der ARF hat die Kommission einen soliden Prüfungs- und Kontrollrahmen geschaffen, der sich auf zwei Säulen stützt. Die erste Säule gewährleistet die Ordnungsmäßigkeit und Rechtmäßigkeit der Ausgaben. Die zweite Säule betrifft den Schutz der finanziellen Interessen der EU (PFIU-Prüfungen). Gemäß Artikel 22 Absatz 1 der ARF-Verordnung sind in erster Linie die Mitgliedstaaten dafür zuständig, die finanziellen Interessen der EU zu schützen und sicherzustellen, dass die Mittelverwendung im Zusammenhang mit den von der ARF unterstützten Maßnahmen mit dem anwendbaren EU-Recht und nationalen Recht in Einklang steht. Die Kommission sollte diesbezüglich von den Mitgliedstaaten eine angemessene Gewähr erhalten.
Ausgehend von den Feststellungen und Empfehlungen der Prüfer der Kommission (einschließlich des Internen Auditdienstes), des Europäischen Rechnungshofs und des Europäischen Parlaments hat die Kommission ihren Prüfungs- und Kontrollrahmen gestärkt, indem sie überprüft hat, wie die Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten die Einhaltung der EU-Vorschriften und nationalen Vorschriften gewährleisten. Auch die Überarbeitungen der ARP boten Gelegenheit, die Angemessenheit und Robustheit der Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten neu zu bewerten und erforderlichenfalls zusätzliche Anforderungen in Form neuer Etappenziele für Prüfungen und Kontrollen in die Pläne aufzunehmen. Die Auszahlung von EU-Mitteln kann nur genehmigt werden, wenn diese Etappenziele zufriedenstellend erreicht werden.
Im Jahr 2023 führte die Kommission 13 PFIU-Systemprüfungen durch.14 Sie erstreckten sich auf 12 Koordinierungsstellen und 58 Durchführungsstellen wie Ministerien oder Agenturen. Bis Ende 2023 wurden alle Mitgliedstaaten mindestens einmal einer Prüfung unterzogen.
Auf der Grundlage der im Jahr 2023 durchgeführten Systemprüfungen haben die Mitgliedstaaten begonnen, die erforderlichen Verbesserungen umzusetzen, die sich aus den Prüfungsfeststellungen in den geprüften Durchführungsstellen, aber auch in anderen einschlägigen Stellen ergeben.
Im Jahr 2023 unterrichtete die Kommission das OLAF über 15 potenzielle Betrugsfälle.
2.3. Die Richtlinie über den Schutz von Hinweisgebern – Stand der Umsetzung15
Bis Ende 2023 hatten 24 Mitgliedstaaten16 nationale Rechtsvorschriften zur Umsetzung der Richtlinie erlassen und ihre Umsetzung für abgeschlossen erklärt.
Die Kommission wird im Juli 2024 einen Bericht über die Übereinstimmung der nationalen Maßnahmen mit der Richtlinie veröffentlichen, um zu bewerten, ob die Bestimmungen der Richtlinie vollständig und richtig umgesetzt wurden, und die wichtigsten festgestellten Mängel aufzuzeigen.
Momentaufnahme 1: Nationale Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie17
In dem diesem Bericht beigefügten Dokument „Maßnahmen der Mitgliedstaaten“ werden die spezifischen Maßnahmen beschrieben, die von fünf Mitgliedstaaten18 zum besseren Schutz von Hinweisgebern ergriffen wurden. Bereits in früheren PIF-Berichten19 wurde die Schlüsselrolle hervorgehoben, die Hinweisgeber bei der Förderung der Aufdeckung, Ermittlung und Verfolgung von Betrug spielen können. Dies kann sich auch auf andere Phasen des Betrugsbekämpfungszyklus (Prävention, Einziehung usw.) positiv auswirken.
2.4. Überarbeitung des Aktionsplans zur Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission
Die derzeitige Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission (CAFS), die 2019 angenommen wurde, zielt darauf ab, die Prävention, Aufdeckung und Sanktionierung von Betrug weiter zu verbessern, und bietet einen Rahmen für die laufenden Bemühungen der Kommission, das Ausmaß von Betrug zulasten des EU-Haushalts zu verringern. Da der dazugehörige Aktionsplan bis 2022 umgesetzt wurde, nahm die Kommission im Juli 2023 einen neuen Aktionsplan an.20
Der neue Aktionsplan umfasst 44 Maßnahmen zu sieben Themen, die die Prioritäten der Kommission bei der Betrugsbekämpfung abdecken. Da die Digitalisierung das erste Thema des Plans ist, konzentriert sich ein Viertel der Maßnahmen auf die Verbesserung der Nutzung von IT-Tools durch die Kommission und die Mitgliedstaaten für die Betrugsbekämpfung, z. B. Arachne, EDES und das Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten (IMS). Im Plan sind auch eine verstärkte Zusammenarbeit innerhalb der Kommission und mit wichtigen externen Partnern und der Zivilgesellschaft vorgesehen, um die EU-Finanzierung zu schützen. Weitere Themen sind die ARF, der Zollbetrug und die weitere Stärkung der Kultur der Ethik und Betrugsbekämpfung in der Kommission.
Die Umsetzung des Aktionsplans ist im Gange.21
2.5. EU-Korruptionsbekämpfungspaket
2.5.1. Richtlinie zur strafrechtlichen Bekämpfung der Korruption
In ihrer Rede zur Lage der Union 2022 kündigte die Präsidentin der Kommission an, dass die Kommission ihren Rechtsrahmen für die Korruptionsbekämpfung aktualisieren werde, indem über klassische Straftaten wie Bestechung hinaus auch schärfere Standards für Straftaten wie illegale Bereicherung, unerlaubte Einflussnahme und Machtmissbrauch eingeführt werden. Um dieser Verpflichtung nachzukommen, nahm die Kommission im Mai 2023 ein Paket von Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung an, einschließlich eines Vorschlags für eine Richtlinie zur Bekämpfung der Korruption22 . Der ehrgeizige Vorschlag zielt darauf ab, die Korruptionsprävention in allen Mitgliedstaaten zu verstärken, Korruptionsdelikte und -sanktionen zu harmonisieren und sicherzustellen, dass die Strafverfolgungs- und Anklagebehörden über die Instrumente verfügen, die sie zur Bekämpfung von Korruption benötigen.
2.5.2. Mitteilung über die Bekämpfung von Korruption
In einer gemeinsamen Mitteilung23 führten die Kommission und der Hohe Vertreter der Union für Außen- und Sicherheitspolitik die bereits geleistete Arbeit zusammen und entwickelten neue Ausrichtungen und Instrumente auf Ebene der EU und der Mitgliedstaaten, um Korruption zu verhindern und zu bekämpfen. All dies mündete auch in eine klare Festlegung, sich der Korruption auf globaler Ebene mit ganzer Kraft entgegenzustellen. Es wurde ein EU-Netz zur Korruptionsbekämpfung eingerichtet, das Strafverfolgungsbehörden, Behörden, Fachleute, die Zivilgesellschaft und andere Interessenträger zusammenbringt, um EU-weit als Katalysator für die Korruptionsprävention zu fungieren, Synergien für die Zusammenarbeit zu schaffen und in Bereichen von gemeinsamem Interesse Best Practices und praktische Anleitungen zu entwickeln. Eine erste Sitzung fand im September 2023 statt.24 OLAF, Eurojust, Europol und die Europäische Staatsanwaltschaft (EUStA) sind alle Mitglieder des Netzwerks. Eine zentrale Aufgabe des Netzwerks wird darin bestehen, die Kommission bei der Ermittlung gemeinsamer Bereiche zu unterstützen, in denen EU-weit ein hohes Korruptionsrisiko besteht. Dieses Ergebnis wird ein Baustein für eine künftige EU-Strategie zur Korruptionsbekämpfung sein.
Innerhalb der EU-Organe besteht Null-Toleranz gegenüber Korruption. In der Mitteilung werden die geltenden Ethik-, Integritäts- und Transparenzvorschriften zur Verhinderung von Korruption in den Institutionen dargelegt.
2.5.3. Ausweitung des Instrumentariums für Sanktionen im Rahmen der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik auf schwere Korruptionsdelikte
Die Sanktionen der EU tragen dazu bei, wichtige Ziele der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik wie die Wahrung des Friedens, die Stärkung der internationalen Sicherheit sowie die Konsolidierung und Unterstützung der Demokratie, des Völkerrechts und der Menschenrechte zu erreichen. Mit dem Vorschlag wird die EU in der Lage sein, schwere Korruptionsdelikte weltweit zu bekämpfen, unabhängig davon, wo sie auftreten. So werden die internen und externen Instrumente der EU zur Korruptionsbekämpfung ergänzt und gestärkt und gezeigt, dass die EU entschlossen ist, alle Instrumente, einschließlich Sanktionen, zu ihrer Bekämpfung einzusetzen.
2.6. Das Betrugsbekämpfungsprogramm der EU
Das Betrugsbekämpfungsprogramm der Union (UAFP) mit einer Mittelausstattung von 181 Mio. EUR für den Zeitraum 2021-2027 sieht finanzielle Unterstützung für i) den Schutz der finanziellen Interessen der EU durch die Mitgliedstaaten, ii) die Organisation der gegenseitigen Amtshilfe und der Zusammenarbeit in Zoll- und Agrarfragen (Informationssystem für die Betrugsbekämpfung – AFIS) sowie iii) die Entwicklung und Pflege des IMS für die Meldung von Unregelmäßigkeiten durch die Mitgliedstaaten vor.
Mit dem Finanzierungsbeschluss 2023 wurden 16,1 Mio. EUR für die Komponente „Hercule“, 8,4 Mio. EUR für die AFIS-Komponente und rund 1 Mio. EUR für die IMS-Komponente bereitgestellt. Die verfügbaren Mittel wurden 2023 mithilfe der verschiedenen verfügbaren Finanzierungsinstrumente erfolgreich eingesetzt.
Im Jahr 2023 erhielt das OLAF seinen ersten Antrag auf Assoziierung von einem Nicht-EU-Land, der Ukraine, im Zusammenhang mit dem UAFP. Zwischen der Kommission (vertreten durch das OLAF) und den zuständigen ukrainischen Behörden wurde ein Assoziierungsabkommen über die Teilnahme der Ukraine an dem Programm ausgehandelt (im März 2024 angenommen).
Das OLAF leitete 2023 eine Zwischenbewertung des Programms ein, die bis Ende 2024 abgeschlossen sein soll. Sie wird mit Unterstützung eines externen Auftragnehmers durchgeführt, der eine unabhängige Bewertungsstudie durchführt. Die Ergebnisse werden wertvolle Beiträge zur Effizienz, Wirksamkeit und Relevanz des Programms liefern und Bereiche aufzeigen, in denen für den verbleibenden Programmplanungszeitraum Verbesserungen möglich sind.
2.7. Die Entschließung des Europäischen Parlaments zum PIF-Bericht 2022
Am 18. Januar 2024 verabschiedete das Europäische Parlament seine Entschließung zum Schutz der finanziellen Interessen der EU für das Jahr 202225 .
Das Parlament begrüßte die von der Kommission im Jahr 2022 eingeleiteten Maßnahmen zur Verbesserung des Schutzes der finanziellen Interessen der EU, forderte jedoch weitere Wachsamkeit und ergänzende Maßnahmen in diesem Bereich. In der Entschließung wird betont, dass durch die Digitalisierung die Betrugsprävention und -aufdeckung verbessert und die Verwaltungsverfahren vereinfacht wurden und dass sie in den Mittelpunkt jeder Betrugsbekämpfungsstrategie gestellt werden muss, einschließlich der nationalen Betrugsbekämpfungsstrategien (NAFS).
Es betonte, dass das EDES ein erhebliches Potenzial hat, um Personen und Unternehmen zu identifizieren, die EU-Mittel missbrauchen, und forderte, dass das System auf alle Arten der Mittelverwaltung ausgeweitet wird, insbesondere auf die geteilte Mittelverwaltung.
Das Parlament forderte die Kommission nachdrücklich auf, ihre Einziehungsquote zu Unrecht ausgegebener Mittel zu verbessern und ihre Kontrolle über die Verwendung der Mittel im Rahmen von NextGenerationEU zu verstärken. Darüber hinaus brachte es seine Ansicht zum Ausdruck, dass die Mittel im Rahmen des Instruments für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit – Europa in der Welt für die Unterstützung von Drittländern und die für die Reaktion der EU auf den Krieg in der Ukraine bereitgestellten Mittel nicht angemessen überwacht und kontrolliert würden.
Ferner empfahl das Parlament, dass die Haushaltsunterstützung für Drittländer, einschließlich Bewerberländern, in denen es den Behörden offenkundig nicht gelingt, konkrete Maßnahmen gegen weitverbreitete Korruption zu ergreifen, ausgesetzt wird, wobei sicherzustellen ist, dass die Hilfe die Zivilbevölkerung über alternative Kanäle erreicht.
Momentaufnahme 2 – Reaktion der Kommission auf die Entschließung des Europäischen Parlaments
Die Kommission ist fest entschlossen, ihre Bemühungen um eine rasche Einziehung missbräuchlich verwendeter Mittel fortzusetzen.
Der Schutz der finanziellen Interessen der EU und die ordnungsgemäße Umsetzung der ARF sind nach wie vor eine zentrale Priorität der Kommission, die die Zahl der im Jahr 2023 durchgeführten Prüfungen erhöht hat und 2024 weiter erhöhen wird.26 Gemäß der Verordnung (EU) 2023/435 müssen die Mitgliedstaaten zweimal im Jahr Informationen zu den 100 Endbegünstigten veröffentlichen, die die höchsten Beträge an Mitteln zur Ausführung von Maßnahmen im Rahmen der ARF erhalten, und die Mitgliedstaaten sind gemäß der ARF-Verordnung verpflichtet, Daten über die Auftragnehmer und Unterauftragnehmer zu erheben. Daten über die wirtschaftlichen Eigentümer werden für Prüfungs- und Kontrollzwecke erhoben und gespeichert.
Die gezielte Überarbeitung der Haushaltsordnung, über die im Januar 2024 eine politische Einigung erzielt wurde, zielt darauf ab, die Effizienz und Qualität der Kontrollen und Prüfungen mithilfe der Digitalisierung und neuer Technologien zu erhöhen.
Die Korruptionsbekämpfung ist eine der Hauptprioritäten in den Beitrittsvorverhandlungen mit einem eingebetteten Konditionalitätsrahmen und einem Schwerpunkt auf dem Kapazitätsaufbau. Programme können ausgesetzt und Mittel freigegeben werden, wenn dies für notwendig erachtet wird.
2.8. Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung
Betrug zum Nachteil des EU-Haushalts kann auch eine Vortat für Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und eine Vorstufe zu anderen Straftaten sein. Daher ist der EU-Rechtsrahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung27 , auch wenn er nicht unmittelbar mit dem Schutz des EU-Haushalts zusammenhängt, in diesem Zusammenhang höchst relevant. Mit der jüngsten Umsetzung eines ambitionierten Legislativpakets28 verstärkt die Kommission weiterhin die Umsetzung des politischen Rahmens zur Bekämpfung der Geldwäsche und strebt eine gute Zusammenarbeit und einen guten Informationsaustausch mit der künftigen Behörde zur Bekämpfung der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung (AMLA)29 an. Die AMLA wird voraussichtlich Mitte 2025 ihre Arbeit aufnehmen.
3. Maßnahmen der Mitgliedstaaten zum Schutz der finanziellen Interessen der EU
3.1. Nationale Betrugsbekämpfungsstrategien
Im Jahr 2023 gaben 21 von 27 Mitgliedstaaten an, dass sie über eine Betrugsbekämpfungsstrategie zum Schutz der finanziellen Interessen der EU verfügten.30 Die Ansätze der 21 Mitgliedstaaten waren sehr unterschiedlich.
Zehn Mitgliedstaaten gaben an, dass sie über eine nationale Betrugsbekämpfungsstrategie verfügten, die alle Ausgabenbereiche abdeckt.31 Sie wurden nicht aufgefordert, weitere bestehende Betrugsbekämpfungsstrategien mit einem eingeschränkteren Anwendungsbereich auszuarbeiten.
Abbildung 2: Überblick über die nationalen Betrugsbekämpfungsstrategien für alle Ausgabenbereiche
| MS | AT | BE | BG | CY | CZ | DE | DK | EE | ES | FI | FR | GR | HR | HU | IE | IT | LT | LU | LV | MT | NL | PL | PT | RO | SE | SI | SK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAFS (all sektoren) | |||||||||||||||||||||||||||
| Verabochiendung geplante | |||||||||||||||||||||||||||
| JA | |||||||||||||||||||||||||||
| NEIN | |||||||||||||||||||||||||||
Was die mögliche Ausarbeitung einer nationalen Betrugsbekämpfungsstrategie betrifft, so befinden sich von den 17 Mitgliedstaaten, die nicht alle Ausgabenbereiche abdecken, drei Mitgliedstaaten32 in der Vorphase der Annahme einer nationalen Betrugsbekämpfungsstrategie, d. h. Festlegung des Rechtsrahmens, einer33 in der Vorbereitungsphase, d. h. Sachstand und Bewertung des Betrugsrisikos, und vier Mitgliedstaaten34 gaben an, weder über eine nationale Betrugsbekämpfungsstrategie noch über ein laufendes Verfahren zur Annahme einer solchen Strategie zu verfügen. Die übrigen neun35 verfügen über andere Betrugsbekämpfungsstrategien.
Abbildung 3: Überblick über andere Betrugsbekämpfungsstrategien, die von den Mitgliedstaaten ohne nationale Betrugsbekämpfungsstrategie für alle Ausgabenbereiche gemeldet wurden
| AT | BE | CY | DE | DK | EE | EL | ES | FI | HR | IE | LT | LU | NL | PL | SE | SI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andere AFS | |||||||||||||||||
| Regional | |||||||||||||||||
| Sektoral national | |||||||||||||||||
| Sektoral regional | |||||||||||||||||
| Korruptionsbekämpfung | |||||||||||||||||
| Behördenebene | |||||||||||||||||
| Programmebene | |||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||
| Abgedeckte Sektoren | |||||||||||||||||
| Kohäsion | |||||||||||||||||
| Landwirtschaft | |||||||||||||||||
| Fischerei | |||||||||||||||||
| Zoll | |||||||||||||||||
| Mehrwertsteuer | |||||||||||||||||
| Ressource für die Aufbau- und Resilienzfazilität | |||||||||||||||||
| Andere Fonds zur gemeinsamen Mittelverwaltung | |||||||||||||||||
| Sonstiges | |||||||||||||||||
3.2. Auf nationaler Ebene verabschiedete Betrugsbekämpfungsmaßnahmen
Die Mitgliedstaaten meldeten insgesamt 69 Maßnahmen. Von den angenommenen Maßnahmen waren 49 Einzelmaßnahmen, die übrigen 20 waren Pakete von Einzelmaßnahmen. Diese Pakete umfassten 39 Maßnahmen. Dies bedeutet, dass von den Mitgliedstaaten insgesamt 88 Einzelmaßnahmen gemeldet wurden, darunter 41 neue Maßnahmen und 44 Aktualisierungen/Änderungen. Darüber hinaus enthielten drei Paketmaßnahmen sowohl neue als auch aktualisierte Maßnahmen.
Abbildung 4: Zusammenfassung der von den Mitgliedstaaten im Jahr 2023 gemeldeten Maßnahmen
| Mitgliedstaat | Ergriffene Maßnahmen |
|---|---|
| Österreich | Zwei Maßnahmen im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik. Die erste Maßnahme zielt darauf ab, den Informationsaustausch zwischen der Meldestelle für Geldwäsche und den einschlägigen nationalen und ausländischen Behörden sowie mit Europol zu erleichtern. Mit der zweiten Maßnahme wird die Kontrolle der von den Begünstigten gemeldeten Ausgaben verstärkt. |
| Belgien | Drei Maßnahmen, von denen zwei bereichsübergreifend sind (Annahme der Rechtsvorschriften zum Schutz von Hinweisgebern und der wallonischen Politik zur Bekämpfung von bereichsübergreifendem Betrug) und eine im Zusammenhang mit der Nutzung von Arachne im Rahmen ihrer Programme des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), des Europäischen Sozialfonds (ESF) und der ARF. |
| Bulgarien | Drei Legislativmaßnahmen zum Umgang mit Unregelmäßigkeiten, zum Schutz von Hinweisgebern und zur Einrichtung einer neuen Korruptionsbekämpfungskommission. |
| Kroatien | Drei Maßnahmen: zwei für die geteilte Mittelverwaltung (Einführung eines neuen IT-Tools für die Überwachung des Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) und Schulungen zur Betrugsbekämpfung durch das OLAF) und eine für die ARF. |
| Zypern | Zwei legislative und eine administrative Maßnahme. Sie betreffen die Einrichtung einer nationalen Koordinierungsstelle für die Bekämpfung von Betrug zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU, die Überwachung der Umsetzung der ARP und die Umsetzung des „Lobbyismus-Gesetzes“. |
| Tschechien | Drei Maßnahmen zum Schutz von Hinweisgebern, zur Bekämpfung von Mehrwertsteuerbetrug und zur Bekämpfung von Korruption und Betrug im Zusammenhang mit EU-Mitteln. |
| Dänemark | Zwei Maßnahmen betreffen Betrugsbekämpfungsstrategien, eine den nationalen ARP und die zweite die Fischereipolitik. Die dritte Maßnahme betrifft die Einführung eines neuen IT-Tools für die Verwaltung von Zahlungen im Rahmen der Kohäsionspolitik. |
| Estland | Die drei Maßnahmen betreffen die Stärkung der Leistungsfähigkeit von Ermittlungen der estnischen Polizei und des Grenzschutzes in Bezug auf Korruption und Wirtschaftskriminalität, die Einführung eines neuen Informationssystems im Zollbereich, und einige Verbesserungen der nationalen Plattform für die elektronische Auftragsvergabe. |
| Finnland | Zwei Maßnahmen: Eine Maßnahme zu einem Zollprojekt mit Schwerpunkt auf Lebensmittelbetrug und eine zweite Maßnahme zu Schulungen zur Betrugsbekämpfung im Bereich der Kohäsionspolitik. |
| Frankreich | Drei Maßnahmen: Zwei Maßnahmen sehen die Einrichtung einer interministeriellen Überwachungsstelle zur Bekämpfung von Betrug im Bereich der öffentlichen Hilfe und einer Arbeitsgruppe zur Analyse neu auftretender Betrugsfälle im Zusammenhang mit der ARF vor, mit der dritten Maßnahme wird ein System der finanziellen Haftung für öffentliche Führungskräfte und die Entwicklung der Beziehungen zwischen der Justizbehörde und den Finanzgerichten eingeführt. |
| Deutschland | Da Deutschland ein föderaler Staat ist, werden Betrugsbekämpfungsmaßnahmen häufig auf regionaler Ebene ergriffen. Drei solcher Maßnahmen wurden in Bezug auf den Einsatz von Instrumenten zur Bewertung des Betrugsrisikos in Berlin, Sachsen und Schleswig-Holstein gemeldet. |
| Griechenland | Mit der ersten Maßnahme werden die Verfahren zur Betrugsprävention und -bekämpfung in das Verwaltungs- und Kontrollsystem der Kohäsionspolitik integriert, die zweite Maßnahme betrifft die Einführung des IT-Tools Arachne im Zusammenhang mit der gemeinsamen Agrarpolitik, die dritte Maßnahme betrifft die Einrichtung einer IT-Plattform zur Sammlung von Beschwerden von Bürgern im Bereich Zoll- und Steuerbetrug. |
| Ungarn | Drei Maßnahmen: In der ersten Maßnahme werden die Aufgaben der Direktion Interne Prüfung und Integrität (DIAI) im Zusammenhang mit der Vermeidung von Interessenkonflikten festgelegt, mit der zweiten Maßnahme wird die Zusammenarbeit zwischen der nationalen Steuer- und Zollverwaltung und der DIAI ausgebaut und die dritte Maßnahme besteht aus einem Plan für Ex-post-Kontrollen des Europäischen Garantiefonds für die Landwirtschaft und einem Prüfungsplan. |
| Irland | Zwei Maßnahmen im Rahmen des ESF+-Programms und der Bekämpfung des Mehrwertsteuerbetrugs im elektronischen Geschäftsverkehr. |
| Italien | Die drei Maßnahmen betreffen den ARP: eine Betrugsbekämpfungsstrategie, die Verbesserung des IT-Tools für die Überwachung und Umsetzung des Plans und die Stärkung der Ermittlungsfunktion der Wirtschafts- und Finanzpolizei im Zusammenhang mit der ARF. |
| Lettland | Drei Maßnahmen: die erste, bereichsübergreifende Maßnahme betrifft die Korruptionsbekämpfung, die zweite Maßnahme konzentriert sich auf den Mehrwertsteuerbetrug im Kfz-Handel und die dritte Maßnahme betrifft die Vergabe öffentlicher Aufträge. |
| Litauen | Drei Maßnahmen, von denen zwei auf die Vergabe öffentlicher Aufträge und auf damit zusammenhängende Fragen im Zusammenhang mit Interessenkonflikten und Korruption ausgerichtet sind und mit einer eine Methodik für die Anwendung von Sanktionen im Zusammenhang mit der Agrar- und Fischereipolitik gebilligt wird. |
| Luxemburg | Eine organisatorische Maßnahme im Zusammenhang mit den Vorarbeiten für die Annahme der nationalen Betrugsbekämpfungsstrategie. |
| Malta | Schulungsprogramme für nationale Beamte im Bereich der Korruptionsbekämpfung. |
| Niederlande | Zwei Maßnahmen zur Meldung von Betrugsverdacht an die EUStA und zur Kontrolle der tatsächlichen Landnutzung. |
| Polen | Zwei Maßnahmen betreffen den ARP: die Annahme von Leitlinien für Kontrollen und die Hinweisgeber-Politik. Die dritte Maßnahme betrifft die Annahme von Leitlinien für die Verfahren für die Gewährung und Auszahlung von Finanzhilfen im Rahmen der gemeinsamen Agrarpolitik (GAP). |
| Portugal | Drei Maßnahmen: eine Aktualisierung der nationalen Betrugsbekämpfungsstrategie, eine Schulungsmaßnahme für Verwaltungsbehörden zur Bewertung des Betrugsrisikos und die Stärkung der systematischen Risikoanalyse im Zollbereich. |
| Rumänien | Die drei Maßnahmen konzentrieren sich auf Mehrwertsteuerbetrug, die Meldung von Betrugsverdachtsfällen an die EUStA und die Annahme der NAFS für den Zeitraum 2023-2027. |
| Slowakei | Drei Maßnahmen: Die erste bietet ein Referenzdokument zu den Maßnahmen zum Schutz der Mittel aus der ARF vor gravierenden Unregelmäßigkeiten, die zweite betrifft die Einrichtung des Ausschusses für Korruptionsbekämpfung und sein Statut und die dritte betrifft Leitlinien zur Bekämpfung von Interessenkonflikten in der GAP. |
| Slowenien | Zwei Maßnahmenpakete, von denen das erste auf die Verstärkung der Kontrollen im Rahmen der GAP und das zweite auf die Einführung einer IT-Plattform im Zoll abzielt. Die dritte Maßnahme betrifft die Berichtigung der Umsetzung der PIF-Richtlinie in nationales Recht. |
| Spanien | Die drei Maßnahmen haben ihren Schwerpunkt auf dem Schutz von Hinweisgebern und dem Schutz der Spanien aus der ARF zugewiesenen Mittel. |
| Schweden | Zwei Maßnahmen, die darauf abzielen, Möglichkeiten zur Verbesserung des Informationsaustauschs und der Zusammenarbeit zwischen den nationalen Behörden zu sondieren. |
3.3. Umsetzung der Empfehlungen von 2022 der Kommission an die Mitgliedstaaten
In ihrem PIF-Bericht 2022 richtete die Kommission drei Empfehlungen an die Mitgliedstaaten, die Folgendes betrafen: a) die Verbesserung der Aufdeckung, Meldung und Weiterverfolgung von Betrugsverdachtsfällen, b) die Notwendigkeit, die Betrugsbekämpfung zu digitalisieren; und c) die Stärkung der Governance im Bereich der Betrugsbekämpfung in den Mitgliedstaaten.36
3.3.1. Verbesserung der Aufdeckung, Meldung und Weiterverfolgung von Betrugsverdachtsfällen
Die meisten Mitgliedstaaten37 geben für ihr Land eine geringe Betrugsinzidenz an. Da es nach wie vor schwierig ist, festzustellen, ob die wenigen gemeldeten Betrugsfälle den Erfolg bestimmter Betrugsbekämpfungsmaßnahmen genau widerspiegeln, ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Mitgliedstaaten weiterhin Betrug aufdecken und melden und gleichzeitig Maßnahmen und Instrumente entwickeln, um ihn zu verhindern. Mehrere Mitgliedstaaten38 geben an, dass sie eine Analyse des Betrugsrisikos durchgeführt hätten, um die Gründe für die geringe Aufdeckung von Betrugsverdachtsfällen zu bewerten.
Während die Hälfte der Mitgliedstaaten, die ihr geringes Betrugsniveau analysiert haben, Schwachstellen bei der Aufdeckung von Betrug festgestellt hat, gaben die meisten an, dass erfolgreiche Maßnahmen zur Betrugsprävention gewährleistet sind, wenn ein Multi-Stakeholder-Ansatz und ein Mehrebenenansatz vorhanden sind. Dies erleichtert die Zusammenarbeit zwischen allen beteiligten inländischen, nationalen und internationalen Akteuren.
Im Rahmen dieser Zusammenarbeit ist es wichtig, dass bestimmte Grundprinzipien beachtet werden:
- eine klare Verteilung der Zuständigkeiten zwischen Prüf- und Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten,
- regelmäßige Verwaltungs- und Vor-Ort-Kontrollen, um das Ausmaß der Betrugsinzidenz gering zu halten,
- kontinuierliche Berichterstattung an die Kommission über das IMS, an die EUStA sowie an die nationalen Prüf- und Kontrollstellen der Mitgliedstaaten; diese Vergleichsdaten können dann verwendet werden, um das Ausmaß des Betrugs zu bewerten;
- Initiativen, die den Wissensaustausch und bewährte Verfahren erleichtern und die Leistung der Mitgliedstaaten vergleichen, wobei den unterschiedlichen Größen, spezifischen Situationen usw. Rechnung zu tragen ist (wie von einigen Mitgliedstaaten angegeben)39 ;
- Schulungen, Leitlinien und Workshops, um die Leistungsfähigkeit und -qualität auf hohem Niveau zu halten,
- interne Mechanismen zur Betrugsbekämpfung werden innerhalb der verschiedenen Einrichtungen gewährleistet, z. B. durch Maßnahmen wie das Vier-Augen-Prinzip innerhalb aller Organe.
3.3.2. Digitalisierung der Betrugsbekämpfung auf Ebene der Mitgliedstaaten
Die Argumente für eine Digitalisierung der Betrugsbekämpfung wurden in den jüngsten PIF-Berichten dargelegt, und auf Ebene der Mitgliedstaaten sind Fortschritte zu verzeichnen.
Unter den umgesetzten Maßnahmen haben die Mitgliedstaaten eine Bestandsaufnahme der vorhandenen Tools, die Aufrechterhaltung der Interoperabilität zwischen diesen Tools und die Entwicklung neuer Tools für die IT-Architektur angegeben. Viele Mitgliedstaaten investieren weiterhin in die Überarbeitung und Entwicklung bestehender IT-Tools, insbesondere des Tools zur Datenauswertung und Risikobeurteilung Arachne. Da mehrere Mitgliedstaaten gerade mit der Umsetzung ihrer nationalen Betrugsbekämpfungsstrategien begonnen haben, wird empfohlen, IT-Tools bereits in einem frühen Stadium zu integrieren.
Mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten40 hat Meldungen zufolge Schritte unternommen, um Qualifikationsdefizite bei der Digitalisierung zu ermitteln und zu beheben, wobei dies hauptsächlich auf einen Mangel an Informationen und/oder fehlenden Zugang zu Daten über die Digitalisierung zurückzuführen ist. Maßnahmen zur Schließung dieser Lücken umfassen häufig den Wissensaustausch, Schulungen und die Erweiterung von Know-how und Kompetenzen im Bereich der Digitalisierung sowie die Weiterentwicklung der verfügbaren Systeme.
Die Entwicklungen im Bereich der neuen Technologien stellen jedoch auch eine potenzielle Bedrohung für die Betrugsbekämpfung dar. Zwar haben mehr als die Hälfte der Mitgliedstaaten41 dieses Problem anerkannt, aber es gibt noch immer mehrere von ihnen42 , die diese Konzepte noch nicht in ihre Betrugsbekämpfungsstrategien integriert haben. Einige Mitgliedstaaten43 haben bereits Maßnahmen zur Ermittlung und Bewältigung der von neuen Technologien ausgehenden Bedrohungen vollständig umgesetzt, die meisten Mitgliedstaaten44 haben jedoch nur einige Maßnahmen umgesetzt.
3.3.3. Stärkung der Governance im Bereich der Betrugsbekämpfung in den Mitgliedstaaten
Die meisten Mitgliedstaaten45 verfügen über ein Netzwerk für die Zusammenarbeit bei der Betrugsbekämpfung, das sich in der Entwicklung befindet. Diese Netzwerke bestehen aus vielen verschiedenen Einrichtungen. Der Umfrage zufolge sind die folgenden Agenturen am häufigsten in den nationalen Betrugsbekämpfungsnetzen vertreten: EU-Fonds-Verwaltungsbehörden, Steuerbehörden, Zollbehörden, nationale Prüfbehörden und Strafverfolgungsbehörden. Abbildung 5 zeigt die verschiedenen Agenturen, die im nationalen Betrugsbekämpfungsnetz vertreten sind (und wie oft sie einbezogen werden). Darüber hinaus arbeiten fast alle Mitgliedstaaten aktiv mit Ermittlungs-, Strafverfolgungs- und Justizbehörden auf EU-Ebene zusammen, insbesondere mit dem OLAF und der EUStA.
Abbildung 5: Bestandsaufnahme der Betrugsbekämpfungsnetze/p>

Die meisten Mitgliedstaaten46 verfügen über ausreichendes Personal in ihrer nationalen Koordinierungsstruktur für die Betrugsbekämpfung. Die Mehrheit der Mitgliedstaaten weist jedoch darauf hin, dass das Fachwissen des Personals verbessert werden müsse.
4. Bekämpfung von Unregelmäßigkeiten, Betrug, Korruption und Interessenkonflikten zum Nachteil des EU-Haushalts
4.1. Allgemeiner Überblick
Aus operativer Sicht obliegt der Schutz der finanziellen Interessen der EU vor Betrug, Unregelmäßigkeiten und anderen rechtswidrigen Handlungen den nationalen Behörden, dem OLAF und der EUStA.
2023 wurden insgesamt 13 563 betrügerische und nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten über einen Betrag von 1,90 Mrd. EUR gemeldet.47 Im Vergleich zu 2022 ist ein leichter Anstieg der gemeldeten Unregelmäßigkeiten (+2,3 %) und der entsprechenden Beträge (+4,6 %) zu verzeichnen.
Die Zahl der betrügerischen Unregelmäßigkeiten, die der Kommission von den nationalen Behörden über das IMS gemeldet wurden, ist in den letzten fünf Jahren relativ stabil geblieben und belief sich 2023 auf 1 030 (-9,5 % gegenüber 2022). Die Schadensbeträge im Zusammenhang mit diesen Fällen variierten stärker, was auf eine begrenzte Zahl von Einzelfällen mit hohen finanziellen Auswirkungen zurückzuführen ist, und sind 2023 auf 585,8 Mio. EUR gestiegen (+103 % im Vergleich zu 2022).
Die Zahl und die finanziellen Auswirkungen der gemeldeten nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten erreichten 2023 ihren Höhepunkt, im Zuge einer steigenden Tendenz in den letzten fünf Jahren, mit 12 533 Unregelmäßigkeiten (+ 3,5 % gegenüber 2022), die sich auf einen Betrag von 1,31 Mrd. EUR (-14 %) beliefen.
Abbildung 6: Gemeldete Unregelmäßigkeiten und damit verbundene Schadensbeträge – 2019-2023; Unregelmäßigkeiten und damit zusammenhängende Schadensbeträge nach Haushaltsbereichen – 2023

4.1.1. Untersuchungen des OLAF
2023 schloss das OLAF Untersuchungen in 265 Fällen ab und sprach 309 Empfehlungen aus, davon 185 finanzielle Empfehlungen über einen zur Einziehung empfohlenen Gesamtbetrag von 1 043,8 Mio. EUR und 209,4 Mio. EUR, bei denen eine unrechtmäßige Verwendung verhindert wurde.48 Im selben Zeitraum wurden 190 neue Untersuchungen eingeleitet, von denen 26 (14 %) Eigenmittel und 2 (1 %) illegalen Handel, 85 (45 %) die geteilte Mittelverwaltung und die ARF, 23 (12 %) die indirekte Mittelverwaltung und 39 (21 %) die direkte Mittelverwaltung betrafen. 18 Untersuchungen (9 %) wurden im Zusammenhang mit internen Angelegenheiten eingeleitet.49
Das OLAF untersuchte Vorwürfe und Fälle von Absprachen, Manipulation von Vergabeverfahren, Interessenkonflikten, überhöhten Rechnungen, Umgehung von Zöllen, Schmuggel und Fälschung. Ein sich abzeichnender Trend, der 2023 sehr sichtbar war, ist die Nutzung von Verwaltungsverstößen, vorzugsweise in künstlich geschaffenen grenzüberschreitenden Situationen, mit dem Ziel des Betrugs zulasten des EU-Haushalts, ohne aufgedeckt zu werden. Eine Tendenz, die 2023 weiter zunahm, waren komplexe Betrugsfälle, die online und in mehreren Rechtsräumen stattfanden.
4.1.2. Untersuchungen der EUStA
2023 leitete die EUStA Untersuchungen in 1 371 Fällen ein, die einem geschätzten Schaden von 12,28 Mrd. EUR entsprechen.50 Ende 2023 gab es bei der EUStA 1 927 aktive Untersuchungen mit einem geschätzten Schaden von 19,27 Mrd. EUR, von denen fast 60 % (11,50 Mrd. EUR) mit 339 Untersuchungen mit MwSt-Bezug in Verbindung standen. Was die auf dem Spiel stehenden finanziellen Interessen der EU betrifft, so entfällt nur ein geringer Anteil (0,3 %) der Schadensbeträge im Zusammenhang mit der Mehrwertsteuer auf den EU-Haushalt.51 1 349 Untersuchungen betrafen Fälle von Ausgabenbetrug mit einem geschätzten finanziellen Schaden von 7,24 Mrd. EUR. 233 dieser Untersuchungen beziehen sich auf Aufbau- und Resilienzprogramme, mit einem geschätzten finanziellen Schaden von 1,86 Mrd. EUR.
Zu den im Rahmen dieser aktiven Untersuchungen ermittelten Tatbeständen zählen 1 486 Straftaten (33,9 % der Gesamtzahl) im Zusammenhang mit Ausgabenbetrug außerhalb der öffentlichen Auftragsvergabe, 379 Straftaten (8,6 %) im Zusammenhang mit Ausgabenbetrug in der öffentlichen Auftragsvergabe, 131 (3 %) im Zusammenhang mit Korruption, 72 (1,6 %) im Zusammenhang mit Veruntreuung, 226 (5,2 %) im Zusammenhang mit Geldwäsche, 405 (9,2 %) im Zusammenhang mit Einnahmenbetrug (ohne Mehrwertsteuerbetrug) und 873 (19,9 %) im Zusammenhang mit Einnahmenbetrug in Form von Mehrwertsteuerbetrug.
4.2. Einnahmen – Traditionelle Eigenmittel52
2023 lag die Zahl der betrügerischen und nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten (5 118) im Zusammenhang mit traditionellen Eigenmitteln (TEM) 10 % über der durchschnittlichen Zahl der in den letzten fünf Jahren gemeldeten Unregelmäßigkeiten. Der geschätzte und festgestellte Gesamtbetrag ging jedoch um 12 % auf 478 Mio. EUR zurück. Gegenüber dem Fünfjahresdurchschnitt für den Zeitraum 2019-2023 ging die Zahl der betrügerischen Unregelmäßigkeiten um 27 % zurück und stieg die Zahl der nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten um 15 %. Der entsprechende geschätzte und festgestellte Betrag ging bei betrügerischen Fällen um 54 % und bei nicht betrügerischen Fällen um weniger als 1 % im Vergleich zum Fünfjahreszeitraum zurück.
Schmuggel ist nach wie vor eine der wichtigsten Vorgehensweisen bei betrügerischen Fällen, während die häufigste Art bei nicht betrügerischen Fällen eine falsche Einreihung/falsche Beschreibung von Waren ist. In monetärer Hinsicht beziehen sich die meisten 2023 gemeldeten Fälle auf den falschen Wert von Waren (1 157 Fälle in Höhe von 165 Mio. EUR). Textilien und Schuhe sind weiterhin die am stärksten betroffenen Waren, was die Anzahl der Fälle und den Wert betrifft. China, die Vereinigten Staaten und Vietnam sind nach wie vor die drei wichtigsten Ursprungsländer der von Unregelmäßigkeiten betroffenen Waren.
Abbildung 7: Festgestellte und gemeldete Unregelmäßigkeiten bei den traditionellen Eigenmitteln und Aufdeckung nach Art der Kontrolle

Momentaufnahme 3: Aufdeckung von Betrug und Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit traditionellen Eigenmitteln
Die Überlassung zum zollrechtlich freien Verkehr ist nach wie vor das Zollverfahren, das am stärksten von Unregelmäßigkeiten betroffen ist (4 236 Fälle mit einem geschätzten und festgestellten Gesamtbetrag von 397 Mio. EUR, was 83 % aller für 2023 gemeldeten Fälle und Beträge entspricht, unabhängig davon, ob betrügerisch oder nicht betrügerisch).
Im Jahr 2023 spielten Kontrollen durch die nationalen Betrugsbekämpfungsstellen (41 % der Fälle und 61 % der Beträge) sowie Zollkontrollen und nachträgliche Zollkontrollen eine entscheidende Rolle bei der Aufdeckung betrügerischer Fälle. Nicht betrügerische Fälle wurden in erster Linie durch nachträgliche Zollkontrollen (44 % der Fälle mit 34 % der Beträge) aufgedeckt, wenngleich auch andere Aufdeckungsmethoden wie Zollkontrollen und Steuerprüfungen erfolgreich waren.
13 Mitgliedstaaten meldeten 87 Fälle geschmuggelter Zigaretten, was fast 13 Mio. EUR des geschätzten TEM-Betrags ausmacht. Im Jahr 2023 wurde die höchste Zahl von Fällen von Litauen gemeldet (23), der höchste TEM-Betrag wurde von Belgien gemeldet (insgesamt 3,8 Mio. EUR). Im Vergleich zu 2022 gibt es in 11 Mitgliedstaaten53 nach wie vor Fälle von Schmuggel, während zwei54 in den Statistiken erneut auftauchen. Dies könnte darauf hindeuten, dass sich Betrug oder Zigarettenschmuggelrouten möglicherweise in andere Mitgliedstaaten verlagern.
Momentaufnahme 4: Gemeinsame Zollaktionen
Gemeinsame Zollaktionen (GZA) sind gezielte Maßnahmen von begrenzter Dauer zur Bekämpfung von Betrug und Schmuggel sensibler Waren in bestimmten Risikobereichen und/oder auf bestimmten Handelsrouten. Im Jahr 2023 wurden 13 GZA vom OLAF mitorganisiert oder unterstützt, die ein breites Spektrum von Zielen abdeckten: von der Bekämpfung des Tabakschmuggels, der illegalen Verbringung von Abfällen, nachgeahmten und minderwertigen onkologischen Arzneimitteln und hormonalen Substanzen, gefälschten Lebensmitteln und Getränken, gefälschtem und/oder gefährlichem Spielzeug bis hin zur Aufdeckung eines zu niedrigen Zollwerts von Waren und dem Schmuggel geschützter Arten55 frei lebender Tiere und Pflanzen.56
4.3. Ausgaben
Dieser Abschnitt deckt die Bereiche der geteilten, indirekten und direkten Mittelverwaltung ab. Die ersten beiden beruhen auf der Analyse betrügerischer und nicht betrügerischer Unregelmäßigkeiten, die über das IMS gemeldet wurden, und Letzterer auf Daten aus dem Rechnungsführungssystem ABAC der Kommission.
4.3.1. Landwirtschaft57
Im Zeitraum 2019-2023 nahmen die von den Mitgliedstaaten für die Entwicklung des ländlichen Raums gemeldeten (betrügerischen und nicht betrügerischen) Unregelmäßigkeiten zu, was hauptsächlich auf steigende Zahlen bei der Aufdeckung im Programmplanungszeitraum 2014-2020 zurückzuführen ist. Die betrügerischen Unregelmäßigkeiten im Rahmen der Unterstützung der Landwirtschaft erreichten 2022 ihren Höhepunkt, als die Zahl von einem Mitgliedstaat beeinflusst wurde, der viele kleine, miteinander verknüpfte Fälle meldete. Die Schadensbeträge im Zusammenhang mit nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten schwankten erheblich, was in erster Linie auf Fälle mit hohen Beträgen für Marktmaßnahmen zurückzuführen ist.
Bei der Entwicklung des ländlichen Raums waren die Aufdeckungsquoten viel höher als bei der Unterstützung der Landwirtschaft. Die höchsten Aufdeckungsquoten entfielen jedoch auf einen Teil der Unterstützung für die Landwirtschaft, nämlich Marktmaßnahmen. Die Aufdeckung von – insbesondere betrügerischen – Unregelmäßigkeiten erfolgte im Wesentlichen in einigen wenigen Mitgliedstaaten.
Im Zeitraum 2019-2023 betrafen betrügerische Unregelmäßigkeiten häufig die Fälschung des Beihilfeantrags oder von Belegen. Auch bei den Marktmaßnahmen und der Entwicklung des ländlichen Raums waren die Verstöße bei der Durchführung der Maßnahme erheblich, was die bereits in früheren Berichten aufgezeigten Muster und Risiken bestätigt.58
Abbildung 8: Gemeldete Unregelmäßigkeiten in der GAP nach Art der Ausgaben59 und Dauer der Unregelmäßigkeiten (vom Beginn des unregelmäßigen Verhaltens bis zum Abschluss des Falls)

Momentaufnahme 5 – Aufdeckung von Betrug und Unregelmäßigkeiten in der gemeinsamen Agrarpolitik
Bei der Entwicklung des ländlichen Raums waren die Aufdeckungsquoten viel höher als bei der Unterstützung der Landwirtschaft. Die höchsten Aufdeckungsquoten entfielen jedoch auf einen Teil der Unterstützung für die Landwirtschaft, nämlich Marktmaßnahmen. Die Aufdeckung von – insbesondere betrügerischen – Unregelmäßigkeiten erfolgte im Wesentlichen in einigen wenigen Mitgliedstaaten.
Im Zeitraum 2019-2023 trug die Risikoanalyse immer noch nur geringfügig zur Aufdeckung von Betrug bei der Entwicklung des ländlichen Raums und den Direktzahlungen an Landwirte bei, während sie bei Marktmaßnahmen eine wichtigere Rolle gespielt zu haben scheint (aber nur, wenn die Kontrolltätigkeiten tatsächlich auf einer Risikoanalyse beruhten). Auch der Anteil der aufgedeckten Betrugsfälle auf der Grundlage von Tipps von Informanten und Hinweisgebern war gering, mit Ausnahme von Marktmaßnahmen, wo er 11 % erreichte. Diese Zahl kann jedoch volatil sein, da sie auf sehr wenigen Fällen beruht. Es wurde kein Betrug aufgrund von Informationen, die in den Medien veröffentlicht wurden, aufgedeckt.
Bei 10 % der im Zeitraum 2014-2023 gemeldeten Unregelmäßigkeiten bestand ein Betrugsverdacht (Betrugsinzidenz). Bei nur 16 % der Unregelmäßigkeiten mit Betrugsverdacht wurde der Verdacht dann als festgestellter Betrug bestätigt, und bei 11 % wurde der Verdacht zurückgewiesen. Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, und diese werden derzeit untersucht.
4.3.2. Kohäsionspolitik60
Die Zahl und die finanziellen Beträge der nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten, die für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 gemeldet wurden, sind viel niedriger als in den ersten zehn Jahren der Durchführung des Programmplanungszeitraums 2007-2013. Betroffen hiervon sind alle Fonds und die meisten Mitgliedstaaten.61 Sie ist viel kleiner, aber in jüngster Zeit ist auch bei der Zahl der als Betrug gemeldeten Unregelmäßigkeiten eine Lücke entstanden.
Abbildung 9: Schwerpunkt auf dem Programmplanungszeitraum 2014-2020 – Unregelmäßigkeiten, aufgeschlüsselt nach Fonds und Typologie


(*) Die Summe entspricht nicht 100% weil eine Unregelmaßigkeit mehr als eine Kategorie betreffen kann.
Bei Betrug waren Belege besonders häufig von Verstößen betroffen. Um hohe Schadensbeträge ging es bei betrügerischen Unregelmäßigkeiten, bei denen es zu Verstößen gegen Vertragsbestimmungen/-vorschriften kam, die häufig in einer unvollständigen oder nicht erfolgten Umsetzung der finanzierten Maßnahme bestanden. Verstöße gegen die Vorschriften über die Vergabe öffentlicher Aufträge waren die am häufigsten gemeldeten nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten. Im Verhältnis zur Zahl der festgestellten Verstöße im Zusammenhang mit der Vergabe öffentlicher Aufträge ist der Prozentsatz der Betrugsfälle gering (4 %).
Die meisten betrügerischen Verstöße gegen Ethik und Integrität standen im Zusammenhang mit Interessenkonflikten (etwa 70 %), während es bei etwa 23 % um Korruption bzw. Bestechung ging.62
Momentaufnahme 6 – Aufdeckung von Betrug und Unregelmäßigkeiten in der Kohäsionspolitik
Im Zeitraum 2019-2023 trug die Risikoanalyse immer noch nur geringfügig zur Aufdeckung von Betrug bei, während die Zivilgesellschaft (einschließlich Tipps von Informanten, Hinweisgebern oder in den Medien veröffentlichten Informationen) insgesamt eine größere Rolle spielte als in den vorangegangenen fünf Jahren. In Bezug auf nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten spielten weder Risikoanalysen noch Informationen aus der Zivilgesellschaft eine spürbare Rolle bei der Aufdeckung.
Die Aufdeckungsquote bei Betrug63 für den Programmplanungszeitraum 2014-2020 lag bei 0,53 %, also ähnlich hoch wie im Programmplanungszeitraum 2007-2013. Die Aufdeckungsquote bei Unregelmäßigkeiten64 lag bei 0,67 % und damit deutlich niedriger als im Programmplanungszeitraum 2007-2013 (2,5 %). Es bestehen erhebliche Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten, und diese werden derzeit untersucht.
4.3.3. Sonstige Haushaltsbereiche65
Eine Reihe von Mitteln, die unter geteilter Mittelverwaltung eingesetzt werden, unterstützen andere interne Politikbereiche, wie die Beschäftigungsinitiative für junge Menschen66 , den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen (FEAD), den Fonds für die innere Sicherheit, den Europäischen Fonds für die Anpassung an die Globalisierung und den Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds. Im mehrjährigen Finanzrahmen 2014-2020 wurden 289 Unregelmäßigkeiten gemeldet (33 davon als betrügerisch), wobei es sich um Schadensbeträge in Höhe von 52 Mio. EUR handelte (davon 8,2 Mio. EUR im Zusammenhang mit betrügerischen Unregelmäßigkeiten, die hauptsächlich den Europäischen Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen betrafen). 44von diesen Unregelmäßigkeiten (mit einem Schadensbetrag von insgesamt 19,71 Mio. EUR) wurden im Jahr 2023 gemeldet.
Mit dem Instrument für Heranführungshilfe (IPA) unterstützt die EU seit 2007 Reformen in der Erweiterungsregion durch finanzielle und technische Hilfe. Bei den im Zeitraum 2019-2023 von den begünstigten Ländern gemeldeten Unregelmäßigkeiten im Bereich Heranführung ging es hauptsächlich um Mittel, die im Rahmen des Instruments für Heranführungshilfe I (IPA I), das sich auf die Jahre 2007-2013 erstreckte, und des IPA II, das die Jahre 2014-2020 abdeckte, verteilt wurden. Im Jahr 2023 erreichten die finanziellen Beträge im Zusammenhang mit betrügerischen Unregelmäßigkeiten einen Höchststand von rund 19 Mio. EUR, was hauptsächlich auf eine von der Türkei im Zusammenhang mit der Komponente „Regionale Entwicklung“ gemeldete Unregelmäßigkeit zurückzuführen ist. Die Zahl der gemeldeten nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten stieg 2022 erheblich an und blieb 2023 hoch.67 Insgesamt betraf die Hälfte der gemeldeten Unregelmäßigkeiten im Zeitraum 2019-2023 weniger als 10 000 EUR.68
Momentaufnahme 7– Risikogebiete vor dem Beitritt
Die meisten Unregelmäßigkeiten (über 70 %) im Rahmen des IPA II betreffen die Komponente Entwicklung des ländlichen Raums. Betrügerische Unregelmäßigkeiten betreffen hauptsächlich die Fälschung von Belegen oder Konten. Für diese Komponente umfassen sie hauptsächlich Projekte zur Erzeugung von Honig und Nutzpflanzen. Nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten sind häufig bei Projekten im Zusammenhang mit dem Erwerb von Ausrüstung (z. B. Traktoren) zu beobachten.
Betrügerische Unregelmäßigkeiten bei anderen Komponenten beziehen sich hauptsächlich auf Projekte zur Unterstützung der Zivilgesellschaft oder des Verkehrs.
Sowohl betrügerische als auch nicht betrügerische Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit im Rahmen der direkten Mittelverwaltung getätigten Ausgaben blieben im Zeitraum 2019-2023 relativ stabil. Mehr als 88 % der als potenziell betrügerisch ermittelten Unregelmäßigkeiten wurden nach Untersuchungen des OLAF aufgedeckt.
4.4. Organisierte Kriminalität, Korruption und Interessenkonflikte
Informationen über organisierte Kriminalität zum Nachteil der finanziellen Interessen der EU sind dem Jahresbericht der EUStA zu entnehmen. Darin wies die EUStA darauf hin, dass sie im Rahmen ihrer aktiven Untersuchungen bis Ende 2023 209 Straftaten im Zusammenhang mit kriminellen Vereinigungen, die sich auf die Schädigung der finanziellen Interessen der Union konzentrierten, untersucht hat.
In Bezug auf Korruption meldete die EUStA bis Ende 2023 131 untersuchte Straftaten69 . Im Zeitraum 2019-2023 wurden von elf Ländern 65 Fälle über das IMS gemeldet, sechs davon betrafen die Landwirtschaft, 56 die Kohäsion und drei die Heranführung. Die gemeldeten unregelmäßigen Beträge im Zusammenhang mit solchen Fällen belaufen sich auf rund 50,5 Mio. EUR.
Im selben Zeitraum wurden über das IMS 419 Fälle von Interessenkonflikt gemeldet (85 % betrafen die Kohäsion, 7 % die Landwirtschaft und 8 % die Heranführung), bei denen es um etwa 112 Mio. EUR ging. Die Analyse solcher Unregelmäßigkeiten zeigt, dass die gemeldeten Interessenkonflikte hauptsächlich Beziehungen zwischen den Empfängern der Mittel und ihren Auftragnehmern und Unterauftragnehmern betreffen und auf spezifischen Verstößen gegen nationale Vorschriften beruhen.
5. Schlussfolgerungen und Empfehlungen
Der EU-Haushalt dient der Finanzierung und Umsetzung der politischen Prioritäten der EU. Durch die Bündelung von Ressourcen und die Solidarität angesichts gemeinsamer Herausforderungen, mit denen die EU konfrontiert ist, schafft der EU-Haushalt einen Mehrwert und stärkt die Wirtschaft Europas und sein geopolitisches Ansehen.
In den letzten Jahren hat sich der EU-Haushalt als wichtigstes Krisenreaktionsinstrument der EU zu einem noch stärkeren Zeichen der Solidarität entwickelt. Er trägt dazu bei, die größten Herausforderungen, vor denen die EU steht, zu bewältigen, darunter die Coronavirus-Pandemie, der Krieg in der Ukraine, die Bekämpfung des Klimawandels, der Aufbau der strategischen Autonomie Europas und die Gewährleistung der Energieunabhängigkeit.
Durch den Schutz dieser Ressourcen vor Betrug und Unregelmäßigkeiten wird sichergestellt, dass sie vollumfänglich ausgeschöpft werden und die angestrebten Ziele erreichen.
Dazu hat die EU im Laufe der Zeit eine komplexe und ausgefeilte Betrugsbekämpfungsarchitektur mit mehreren Schutzebenen auf nationaler und EU-Ebene entwickelt. Die kontinuierlichen Maßnahmen der Kontroll- und Untersuchungsstellen sowohl auf EU-Ebene als auch auf nationaler Ebene haben zur Aufdeckung und Verfolgung einer erheblichen Zahl von Betrugsversuchen zum Nachteil des EU-Haushalts geführt. Der repressive Aspekt der Betrugsbekämpfung ist jedoch nur eine Seite der Medaille, und die Kommission hat stets betont, wie wichtig die Betrugsprävention ist.
Da sich die Betrugslandschaft ständig weiterentwickelt und neue Herausforderungen entstehen, muss auch die Reaktion darauf kontinuierlich angepasst werden. In dieser Hinsicht sind drei Elemente von entscheidender Bedeutung: Kenntnisse, Tools und Governance-Strukturen im Bereich der Betrugsbekämpfung.
5.1. Aufbau von Wissen über die Betrugsbekämpfung auf der Grundlage vollständiger, zuverlässiger und aktueller Daten
In früheren Berichten hat die Kommission wiederholt auf die Notwendigkeit vollständiger, zuverlässiger und aktueller Daten über Betrug und Unregelmäßigkeiten hingewiesen. Diese Informationen bilden die Grundlage für das Wissen, das erforderlich ist, um Betrug wirksamer zu bekämpfen und letztlich die Prävention, Aufdeckung, Untersuchung und strafrechtliche Verfolgung von Betrugsdelikten zu verbessern. Auch wenn sich die Datenqualität ständig verbessert, zeigt die in diesem Jahr durchgeführte Analyse erneut, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind. Wie in Abschnitt 1.2 dargelegt, können Untersuchungen von EU-Einrichtungen zu Betrug nur gemeldet werden, wenn die erforderlichen Informationen an die zuständigen nationalen Behörden weitergegeben werden. Einige Fälle der EUStA und des OLAF sind bereits in den in diesem Bericht aufgeführten Zahlen enthalten. Die Kommission arbeitet daran, dass die Meldesysteme alle Informationen erfassen können, die für die Ermittlung der von ihnen untersuchten Fälle erforderlich sind. Sobald diese Informationen vollständig verfügbar sind, kann beurteilt werden, ob sich die Trends im Zusammenhang mit der Betrugsaufdeckung ändern oder ob sie kohärent sind und den im Laufe der Jahre gemeldeten Betrugsbekämpfungsergebnissen der nationalen Ermittlungsbehörden entsprechen.
Empfehlung 1: Verbesserung der Meldung und Weiterverfolgung von Betrugsverdachtsfällen
Die Meldung und die Weiterverfolgung von Betrugsverdachtsfällen können noch erheblich verbessert werden. Die Mitgliedstaaten müssen sicherstellen, dass gemeldete Betrugsverdachtsfälle zeitnah mit zuverlässigen und vollständigen Informationen und Daten aktualisiert werden. Zu diesem Zweck sind die Einrichtung geeigneter Kommunikationskanäle mit den Strafverfolgungs- und Anklagebehörden, der Austausch von Informationen mit Ermittlungsstellen und eine zeitnahe Berichterstattung Voraussetzung für wirksame Folgemaßnahmen.
Eine umfassende Berichterstattung bedeutet auch, dass die nationalen Behörden Unregelmäßigkeiten und Betrug melden, die von den Prüfdiensten der Kommission, dem Europäischen Rechnungshof, OLAF und der EUStA aufgedeckt wurden, sobald die erforderlichen Informationen vorliegen.
5.2. Bessere Tools: Beschleunigung der Digitalisierung der Betrugsbekämpfung
Die Digitalisierung der Betrugsbekämpfung ist eines der zentralen Themen des überarbeiteten Aktionsplans zur Betrugsbekämpfungsstrategie. Mit diesem und früheren PIF-Berichten hat die Kommission Informationen über Maßnahmen der EU und der Mitgliedstaaten zur Digitalisierung der Betrugsbekämpfung bereitgestellt, was zeigt, dass es eine positive Dynamik gibt, um sicherzustellen, dass die Betrugsbekämpfung mit den neuesten technologischen Entwicklungen Schritt hält.
Dennoch muss dieser Prozess nun beschleunigt werden, und die Entwicklung neuer oder bestehender IT-Tools sollte mit ihrem verstärkten Einsatz einhergehen, um Betrug in allen von den Mitgliedstaaten ausgeführten Haushaltsbereichen effizienter zu bekämpfen. Parallel dazu wird die Kommission die Umsetzung der spezifischen Maßnahmen im überarbeiteten Aktionsplan, der die Betrugsbekämpfungsstrategie begleitet, fortsetzen.
Empfehlung 2: Beschleunigung der Digitalisierung der Betrugsbekämpfung
Die Digitalisierung der Betrugsbekämpfung muss im Mittelpunkt der Betrugsbekämpfungsstrategien stehen. Da Betrüger zunehmend neue Technologien einsetzen und nutzen, um Straftaten zu begehen, muss die Betrugsbekämpfungsarchitektur der EU der Herausforderung gewachsen sein, um Betrug zu verhindern, aufzudecken und zu untersuchen.
Die Mitgliedstaaten sollten sicherstellen, dass die Digitalisierung der Betrugsbekämpfung Teil ihres strategischen Ansatzes zur Betrugsbekämpfung ist.
Die Mitgliedstaaten sollten mit den Vorbereitungen für die nächste Phase der Entwicklung des Tools zur Datenauswertung und Risikobeurteilung der Kommission beginnen. Alle Mitgliedstaaten müssen ab dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen Daten in das Tool einspeisen. Bei solchen Vorbereitungen könnten die automatische Einspeisung angeforderter Daten und die Interoperabilität mit den nationalen Systemen getestet werden.
5.3. Entwicklung der Governance der Betrugsbekämpfungsarchitektur
Die Kommission begrüßt die Fortschritte, die in allen Mitgliedstaaten beim Aufbau einer wirksamen Betrugsbekämpfungspolitik und bei der Entwicklung strategischer Konzepte zur Betrugsbekämpfung auf nationaler, regionaler oder sektoraler Ebene erzielt wurden. Die Einrichtung spezifischer Netzwerke, in denen nationale Akteure im Bereich der Betrugsbekämpfung zusammenkommen, schafft die Grundlage für den möglichst effizienten Austausch von bewährten Verfahren, Wissen, Erfahrungen und Fachwissen.
Diese Netzwerke schaffen die idealen Voraussetzungen für die Entwicklung starker Betrugsbekämpfungsstrategien, die auf umfassenden Bewertungen des Betrugsrisikos beruhen. Sie können dazu beitragen, Schwachstellen und Bedrohungen richtig zu erkennen, wirksame Abhilfemaßnahmen zu entwickeln, konkrete Ziele festzulegen und im Falle plötzlicher Veränderungen in der Betrugsbekämpfungslandschaft rechtzeitig Korrekturmaßnahmen zu ergreifen.
Empfehlung 3: Stärkung der Governance im Bereich der Betrugsbekämpfung in den Mitgliedstaaten
Die Mitgliedstaaten werden aufgefordert, ihre Governance-Strukturen für die Betrugsbekämpfung weiter zu stärken und dafür zu sorgen, dass sie alle relevanten Akteure einbeziehen.
Von zentraler Bedeutung hierfür ist die Annahme aller erforderlichen Strategien zur Betrugsbekämpfung, idealerweise auf nationaler Ebene (durch die Annahme einer nationalen Betrugsbekämpfungsstrategie).
Anhänge
des Berichts Der Kommission an Den Rat und Das Europäische Parlament
35. Jahresbericht über den Schutz der finanziellen Interessen der Europäischen Union und die Betrugsbekämpfung
2023
Anhang 1 – Als betrügerisch gemeldete Unregelmäßigkeiten im Jahr 202370
Die Zahl der als betrügerisch gemeldeten Unregelmäßigkeiten ist ein Maß für die Ergebnisse der Anstrengungen der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung von Betrug und sonstigen gegen die finanziellen Interessen der EU gerichteten rechtswidrigen Handlungen. Diese Zahlen sollten daher nicht als Indikator für das Ausmaß von Betrug in den betreffenden Ländern gewertet werden. Drittstaaten (Heranführungsländer), das Vereinigte Königreich und direkte Ausgaben sind im Anhang zum Bericht über den Schutz der finanziellen Interessen nicht berücksichtigt.
Anhang 2 – Als nicht betrügerisch gemeldete Unregelmäßigkeiten im Jahr 202372
Drittstaaten (Heranführungsländer), das Vereinigte Königreich und direkte Ausgaben sind im Anhang zum Bericht über den Schutz der finanziellen Interessen nicht berücksichtigt.
ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS
| AFIS | Informationssystem für die Betrugsbekämpfung |
| KI | Künstliche Intelligenz |
| CAFS | Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission |
| GAP | Gemeinsame Agrarpolitik |
| DIAI | Ungarische Direktion Interne Prüfung und Integrität |
| EDES | Früherkennungs- und Ausschlusssystem |
| EUStA | Europäische Staatsanwaltschaft |
| EFRE | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung |
| ESF | Europäischer Sozialfonds |
| EU | Europäische Union |
| FEAD | Europäischer Hilfsfonds für die am stärksten benachteiligten Personen |
| IMS | Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten |
| IPA | Instrument für Heranführungshilfe |
| GZA | Gemeinsame Zollaktion |
| NAFS | Nationale Betrugsbekämpfungsstrategien |
| OLAF | Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung |
| PIF | Schutz der finanziellen Interessen |
| PFIU-Prüfungen | Prüfungen zum Schutz der finanziellen Interessen der Union |
| ARF | Aufbau- und Resilienzfazilität |
| ARP | Nationaler Aufbau- und Resilienzplan |
| AEUV | Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union |
| TEM | Traditionelle Eigenmittel |
| UAFP | Betrugsbekämpfungsprogramm der Union |
| MwSt | Mehrwertsteuer |
Endnoten
1 Artikel 310 Absatz 6 AEUV.
2 Diesem PIF-Bericht sind sieben Arbeitsunterlagen der Kommissionsdienststellen beigefügt:
- Sachstand und Bewertung der nationalen Betrugsbekämpfungsstrategien (NAFS),
- Maßnahmen der Mitgliedstaaten zum Schutz der finanziellen Interessen der EU im Jahr 2023,
- Folgemaßnahmen zu den Empfehlungen im Bericht der Kommission über den Schutz der finanziellen Interessen der EU und die Betrugsbekämpfung 2022,
- Statistische Evaluierung der 2023 gemeldeten Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Eigenmittel, natürliche Ressourcen, Kohäsionspolitik, Heranführungshilfe und direkte Ausgaben,
- Überarbeitung des Aktionsplans zur Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission (CAFS),
- Früherkennungs- und Ausschlusssystem (EDES) – Gremium nach Artikel 143 der Haushaltsordnung,
- Jährlicher Überblick mit Informationen über die Ergebnisse des Betrugsbekämpfungsprogramms der Union im Jahr 2023.
3 Siehe insbesondere Kasten 2 des PIF-Berichts 2021, Abschnitt 6.1, S. 31.
4 Der Kommission über das Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten (IMS) gemeldet.
5 Eine Beschreibung dieser Beschränkungen findet sich in Kasten 3 im PIF-Bericht 2021, Abschnitt 6.1, S. 32.
6 Bei betrügerischen Unregelmäßigkeiten handelt es sich um Unregelmäßigkeiten, die das Meldeland im Bereich der traditionellen Eigenmittel als Betrug oder im Bereich der geteilten Mittelverwaltung und der Heranführungshilfe als vermuteten Betrug oder aufgedeckten Betrug eingestuft hat.
7 Alle Unregelmäßigkeiten, die nicht als betrügerisch eingestuft wurden, gelten als nicht betrügerisch.
8 https://ec.europa.eu/olaf-report/2023/index_en.html
9 https://www.eppo.europa.eu/sites/default/files/2024-03/EPPO_Annual_Report_2023.pdf
10 Gesamtzahl der Ermittlungen und geschätzter finanzieller Schaden, Zahl der Ermittlungen im Zusammenhang mit MwSt-Betrug und damit verbundener geschätzter finanzieller Schaden.
11 Diese Statistiken werden in Form aggregierter Daten zu allen laufenden Ermittlungen bereitgestellt, einschließlich derjenigen, die in den Vorjahren eingeleitet wurden und noch nicht abgeschlossen sind. Sie umfassen unter anderem die Zahl der untersuchten Straftaten, aufgeschlüsselt nach Art, und die Zahl der Ermittlungen, aufgeschlüsselt nach Ausgabenprogrammen. Andere aggregierte Statistiken über die Tätigkeiten der EUStA beziehen sich auf die gerichtlichen Tätigkeiten und die Zahl der von nationalen Behörden eingegangenen Beschwerden oder Meldungen.
12 Der Ablauf der Meldung durch die Mitgliedstaaten und letztlich die Verfügbarkeit vollständiger Daten für die Erstellung dieses Berichts hängen in hohem Maße von Informationen der Behörden ab, die die Unregelmäßigkeit oder den Betrug aufdecken und untersuchen. Die Meldestellen in den Mitgliedstaaten (hauptsächlich Verwaltungsbehörden oder Zahlstellen im Bereich der geteilten Mittelverwaltung und Zollbehörden im Bereich der traditionellen Eigenmittel) dürfen nur dann über strafrechtliche Ermittlungen berichten, wenn ihnen die zuständigen Justiz- oder Strafverfolgungsbehörden die Genehmigung erteilen und die erforderlichen Informationen bereitstellen. Dies bedeutet, dass die für die Meldung von Unregelmäßigkeiten und Betrug an die Kommission zuständigen Stellen in bestimmten Fällen aufgrund der möglichen Vertraulichkeit der Untersuchungen nicht in der Lage sind, dies zu tun, während EPPO, OLAF oder die nationalen Strafverfolgungsbehörden einen Fall aktiv untersuchen. In solchen Fällen werden diese Informationen erst nach Abschluss der Untersuchung verfügbar sein und werden daher erst zu diesem Zeitpunkt in den PIF-Bericht aufgenommen.
13 Bei diesen Beträgen handelt es sich in der Regel meist um diejenigen, bei denen die Einziehung wirksam betrieben wird.
14 Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal, Rumänien, Slowakei, Schweden und Ungarn.
15 Richtlinie (EU) 2019/1937 zum Schutz von Personen, die Verstöße gegen das Unionsrecht melden (ABl. L 305 vom 26.11.2019, S. 17).
16 Alle Mitgliedstaaten außer Belgien, Estland und Polen.
17 Weitere Maßnahmen zur Umsetzung der Richtlinie, die von fünf Mitgliedstaaten – Belgien, Frankreich, Griechenland, Rumänien und Zypern – gemeldet wurden, sind in der Unterlage „Maßnahmen der Mitgliedstaaten zum Schutz der finanziellen Interessen der EU“ beschrieben, die dem PIF-Bericht 2022 beigefügt ist.
18 Belgien, Bulgarien, Polen, Spanien und Tschechien.
19 Siehe Abschnitt 4.4 des PIF-Berichts 2022 und Empfehlung 2 (S. 28) des PIF-Berichts 2017.
20 COM(2023) 405 final und SWD(2023) 245 final.
21 Eine vollständige Übersicht über den Stand der Umsetzung der Maßnahmen findet sich in der diesem Bericht beigefügten Unterlage „Commission Anti-Fraud Strategy (CAFS) action plan state-of-play May 2024“ (Aktionsplan zur Betrugsbekämpfungsstrategie der Kommission (CAFS) – Sachstand Mai 2024).
22 COM(2023) 234 final.
23 JOIN(2023) 12 final vom 3. Mai 2023.
24 EU network against corruption – Europäische Kommission (europa.eu).
25 Verfahrensakte 2023/2045(INI).
26 Siehe Abschnitt 2.2.
27 Anti-money laundering and countering the financing of terrorism at EU level – Europäische Kommission (europa.eu). Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts haben alle Mitgliedstaaten die vollständige Umsetzung der fünften Geldwäscherichtlinie (EU-Richtlinie 2018/843) zur Verhinderung der Nutzung des Finanzsystems zum Zwecke der Geldwäsche und der Terrorismusfinanzierung gemeldet.
28 Anti-money laundering and countering the financing of terrorism legislative package – Europäische Kommission (europa.eu).
29 AMLA – Europäische Kommission (europa.eu).
30 Die Informationen wurden mittels eines speziellen Fragebogens zusammengetragen. Siehe die diesem Bericht beigefügte Unterlage „Maßnahmen der Mitgliedstaaten zur Umsetzung von Artikel 325 AEUV“.
31 Für eine detaillierte Analyse der Betrugsbekämpfungsstrategien siehe die Unterlage „Nationale Betrugsbekämpfungsstrategien (NAFS): Sachstand und Bewertung“, die diesem Bericht beigefügt ist.
32 Dänemark, Litauen, Niederlande.
33 Luxemburg.
34 Irland, Kroatien, Schweden, Slowenien.
35 Belgien, Deutschland, Estland, Finnland, Griechenland, Österreich, Polen, Spanien und Zypern.
36 Einen vollständigen Überblick und eine detaillierte Beschreibung der in diesem Abschnitt zusammengefassten Folgemaßnahmen finden Sie in der diesem Bericht beigefügten Unterlage „Umsetzung der Empfehlungen von 2022 durch die Mitgliedstaaten“.
37 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Griechenland, Irland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Slowakei, Spanien, Tschechien und Ungarn.
38 Belgien, Bulgarien, Deutschland, Finnland, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Malta, Niederlande, Österreich, Portugal, Spanien, Slowenien, Tschechien und Ungarn.
39 Estland, Griechenland und Italien.
40 Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern.
41 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Frankreich, Griechenland, Italien, Lettland, Litauen, Malta, Österreich, Portugal, Slowakei, Slowenien, Spanien und Ungarn.
42 Deutschland, Finnland, Kroatien, Niederlande, Polen, Rumänien, Schweden, Tschechien, Zypern.
43 Deutschland, Italien, Polen, Rumänien.
44 Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Lettland, Litauen, Österreich, Portugal, Schweden, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn.
45 Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Italien, Kroatien, Lettland, Malta, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn und Zypern. In der Entwicklungsphase: Belgien, Irland, Litauen und Niederlande.
46 Ausreichendes Personal mit den erforderlichen Fachkenntnissen: Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Griechenland, Italien, Österreich, Slowenien, Tschechien und Ungarn. Der Personalstand muss verbessert werden: Zypern, Estland, Finnland, Frankreich, Lettland, Malta, Niederlande, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Slowakei und Spanien.
47 Unregelmäßigkeiten wurden von den Mitgliedstaaten und Nicht-EU-Ländern im IMS in Bezug auf die Ausgaben und in OWNRES in Bezug auf die TEM gemeldet. Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der direkten Mittelverwaltung werden aus dem Rechnungsführungssystem ABAC der Kommission extrahiert.
48 Die in diesem Abschnitt angeführten Daten sind im Jahresbericht 2023 des OLAF enthalten.
49 Die Summe der eingeleiteten Untersuchungen pro Haushaltsbereich ist höher als die Gesamtzahl der 2023 eingeleiteten Untersuchungen (190), da eine Untersuchung mehr als einen Sektor betreffen kann.
50 Die in diesem Abschnitt angeführten Daten sind im Jahresbericht 2023 der EUStA enthalten.
51 Für den Zeitraum 2021-2027 wird auf die MwSt-Bemessungsgrundlage jedes Mitgliedstaats ein einheitlicher Abrufsatz von 0,3 % angewandt.
52 Eine detaillierte Analyse der von den Mitgliedstaaten gemeldeten Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit traditionellen Eigenmitteln findet sich in Abschnitt 2 der diesem Bericht beigefügten Unterlage „Statistische Evaluierung der 2023 gemeldeten Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Eigenmittel, natürliche Ressourcen, Kohäsionspolitik, Heranführungshilfe und direkte Ausgaben“.
53 Belgien, Bulgarien, Deutschland, Estland, Frankreich, Griechenland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien und Spanien.
54 Slowakei und Finnland.
55 Nach dem Übereinkommen über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten frei lebender Tiere und Pflanzen.
56 Siehe Jahresbericht 2023 des OLAF.
57 Eine detaillierte Analyse der von den Mitgliedstaaten gemeldeten Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Landwirtschaft findet sich in Abschnitt 3 der diesem Bericht beigefügten Unterlage „Statistische Evaluierung der 2023 gemeldeten Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Eigenmittel, natürliche Ressourcen, Kohäsionspolitik, Heranführungshilfe und direkte Ausgaben“.
58 Siehe Momentaufnahme 3 in Abschnitt 4.3.1 des PIF-Berichts 2022.
59 Die Aufdeckungsquote bei Betrug (FDR) wird als prozentualer Anteil der Schadensbeträge im Zusammenhang mit betrügerischen Unregelmäßigkeiten an den Gesamtzahlungen berechnet. Die Aufdeckungsquote bei Unregelmäßigkeiten (IDR) wird als prozentualer Anteil der Schadensbeträge im Zusammenhang mit nicht betrügerischen Unregelmäßigkeiten an den Gesamtzahlungen berechnet.
60 Eine detaillierte Analyse der von den Mitgliedstaaten im Zusammenhang mit der Kohäsionspolitik gemeldeten Unregelmäßigkeiten findet sich in Abschnitt 4 der dem Bericht beigefügten Unterlage „Statistische Evaluierung der 2023 gemeldeten Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Eigenmittel, natürliche Ressourcen, Kohäsionspolitik, Heranführungshilfe und direkte Ausgaben“.
61 Eine eingehende Analyse dieses Trends wurde im PIF-Bericht 2021 veröffentlicht, Momentaufnahme 17, S. 38.
62 Siehe auch Abschnitt 4.4.
63 Siehe Fußnote 48.
64 Siehe Fußnote 48.
65 Eine detaillierte Analyse der von den Mitgliedstaaten gemeldeten Unregelmäßigkeiten im Zusammenhang mit der Heranführungshilfe und der direkten Mittelverwaltung findet sich in den Abschnitten 5 und 6 der diesem Bericht beigefügten Unterlage „Statistische Evaluierung der 2023 gemeldeten Unregelmäßigkeiten in den Bereichen Eigenmittel, natürliche Ressourcen, Kohäsionspolitik, Heranführungshilfe und direkte Ausgaben“.
66 Im Mehrjährigen Finanzrahmen 2021-2027 ist die Initiative Teil der europäischen Struktur- und Investitionsfonds.
67 Im PIF-Bericht 2022 wurde ein Gesamtbetrag von 79,70 Mio. EUR als von Unregelmäßigkeiten betroffen gemeldet. Dieser Betrag war weitgehend auf von Albanien gemeldete Unregelmäßigkeiten in Höhe von insgesamt 33,53 Mio. EUR zurückzuführen. Dieser Betrag war jedoch das Ergebnis einiger Meldefehler der albanischen Behörden im Zusammenhang mit der falschen Verwendung der nationalen Währungen anstelle des Euro. Der von Albanien für 2022 gemeldete korrigierte unregelmäßige Betrag beläuft sich auf 2,89 Mio. EUR.
68 Während der Schwellenwert für die Berichterstattung im Rahmen der geteilten Mittelverwaltung 10 000 EUR beträgt, gibt es für die Heranführung keinen Schwellenwert.
69 Dies entspricht 3 % der von der EUStA untersuchten Straftaten. Siehe Abschnitt 4.1.2.
70 Auf der Grundlage von Daten im Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten (IMS) (Stand: 4.3.2024) für Ausgaben und von Daten in der OWNRES-Anwendung (Stand: 15.3.2024) für Einnahmen.
71 Die Daten in dieser Spalte umfassen auch vier Fälle (RO) im Zusammenhang mit dem Europäischen Nachbarschaftsinstrument.
72 Auf der Grundlage von Daten im Berichterstattungssystem für Unregelmäßigkeiten (IMS) (Stand: 4.3.2024) für Ausgaben und von Daten in der OWNRES-Anwendung (Stand: 15.3.2024) für Einnahmen.
73 Die Daten in dieser Spalte umfassen auch vier Fälle (PL) im Zusammenhang mit dem Europäischen Nachbarschaftsinstrument.
Kontakt
| ISBN 978-92-68-15544-8 | doi:10.2784/830115 | OB-AE-24-001-DE-C | |
| ISBN 978-92-68-15536-3 | doi:10.2784/286209 | OB-AE-24-001-DE-N | |
| HTML | ISBN 978-92-68-15538-7 | doi:10.2784/618678 | OB-AE-24-001-DE-Q |
More information on the European Union is available on the internet (https://europa.eu).
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2024
© European Union, 2024
The reuse policy of European Commission documents is implemented based on Commission Decision 2011/833/EU of 12 December 2011 on the reuse of Commission documents (OJ L 330, 14.12.2011, p. 39).
Except otherwise noted, the reuse of this document is authorised under a Creative Commons Attribution 4.0 International (CC-BY 4.0) licence (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). This means that reuse is allowed provided appropriate credit is given and any changes are indicated. For any use or reproduction of elements that are not owned by the European Union, permission may need to be sought directly from the respective rightholders.
DIE EU KONTAKTIEREN
Besuch
In der Europäischen Union gibt es Hunderte von „Europa Direkt“-Zentren. Ein Büro in Ihrer Nähe können Sie online finden (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de).
Per Telefon oder schriftlich
Der Europa-Direkt-Dienst beantwortet Ihre Fragen zur Europäischen Union. Kontaktieren Sie Europa Direkt
- über die gebührenfreie Rufnummer: 00 800 6 7 8 9 10 11 (manche Telefondienstanbieter berechnen allerdings Gebühren),
- über die Standardrufnummer: +32 22999696,
- über das folgende Kontaktformular: european-union.europa.eu/contact-eu/write-us_de.
INFORMATIONEN ÜBER DIE EU
Im Internet
Auf dem Europa-Portal finden Sie Informationen über die Europäische Union in allen Amtssprachen (european-union.europa.eu).
EU-Veröffentlichungen
Sie können EU-Veröffentlichungen einsehen oder bestellen unter op.europa.eu/de/publications.
Wünschen Sie mehrere Exemplare einer kostenlosen Veröffentlichung, wenden Sie sich an Europa Direkt oder das Dokumentationszentrum in Ihrer Nähe (european-union.europa.eu/contact-eu/meet-us_de).
Informationen zum EU-Recht
Informationen zum EU-Recht, darunter alle EU-Rechtsvorschriften seit 1951 in sämtlichen Amtssprachen, finden Sie in EUR-Lex (eur-lex.europa.eu).
Offene Daten der EU
Das Portal data.europa.eu bietet Zugang zu offenen Datensätzen der Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der EU. Die Datensätze können zu gewerblichen und nicht gewerblichen Zwecken kostenfrei heruntergeladen werden. Über dieses Portal ist auch eine Fülle von Datensätzen aus den europäischen Ländern abrufbar.



